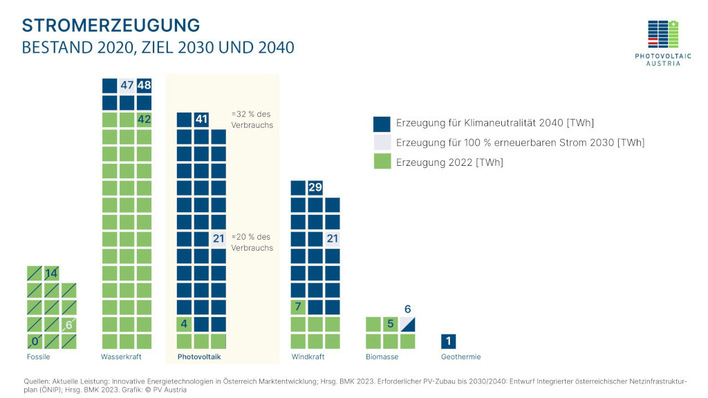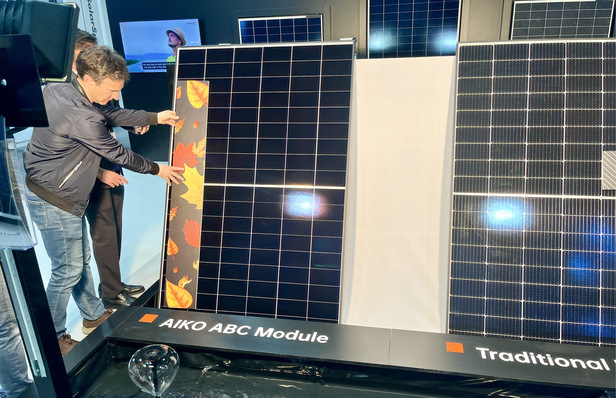Befragt man Solarunternehmen zum Thema Outsourcing, üben sie sich in Zurückhaltung. Zu groß scheint die Angst vor negativen Schlagzeilen zu sein. Denn die Auslagerung der Produktion, womöglich noch nach Fernost, hat ein schlechtes Image. Seit der Begriff „Outsourcing“ 1996 zum Unwort des Jahres gekürt wurde, hat sich daran nicht viel geändert. Es sei ein „Imponierwort, das der Auslagerung und Vernichtung von Arbeitsplätzen einen seriösen Anstrich geben soll“, urteilte die Jury damals. So denken die meisten noch heute.
Doch Billiglöhne sind nicht immer der Grund, wenn Solarunternehmen die Modulfertigung auslagern. Es geht dabei auch um die technischen Möglichkeiten, die eine Fremdfirma bietet. Es geht um staatliche Subventionen am Produktionsstandort und um verteilte Risiken. Und vor allem: Outsourcing heißt nicht automatisch Fernost. Eine Auslagerung kann genauso gut in Deutschland stattfinden, sogar im gleichen Ort. „Beim Outsourcing wird eine Aufgabe an eine Drittfirma übergeben, die gesellschaftlich nicht mit dem Unternehmen zusammenhängt“, erklärt Arun Chaudhuri, Professor für Neue Arbeitsorganisation an der Hochschule für Ökonomie und Management in München. Er betont, wie wichtig es sei, das Thema differenzierter zu betrachten: „Berücksichtigt man alle unternehmerischen Auslagerungen, die vor allem Personalverwaltung, Buchhaltung oder Gebäudemanagement betreffen, findet Outsourcing bis zu 90 Prozent im Inland statt“, sagt er.
Outsourcing-Boom hält an
Was in den 50er Jahren damit begann, einfache Aufgaben, wie Sicherheitsdienst und Logistik an andere Unternehmen zu übertragen, wurde in den 90er Jahren zur Auslagerung von ganzen Produktions prozessen. Anfang des neuen Jahrhunderts ging es dann vorzugsweise nach Asien, angelockt von geringen Produktionskosten und verstärkt durch die Globalisierung. Die noch junge Solarindustrie stieg zu diesem Zeitpunkt gerade erst ins Marktgeschehen ein und wuchs mit den neuen Möglichkeit auf.
Viele folgten dem Trend, der bis heute ungebrochen ist. Denn auch in diesem Jahr erklärten wieder namhafte Solarunternehmen, dass sie ihre Module in Zukunft von einem Electronics Manufacturing Service (EMS), einem Fertigungsdienstleister für elektronische Baugruppen, herstellen lassen. Als Gründe gaben sie Expansion und Kostendruck an. Eines der bekanntesten EMS-Unternehmen ist Flextronics mit Firmensitz in Singapur (siehe auch ab Seite 56). Über 30 Fabriken hat das Unternehmen, hauptsächlich in Niedriglohnländern wie Brasilien, China und Malaysia, aber auch Ungarn, Polen und der Ukraine. Seit diesem Jahr hat Flextronics, neben Solarmodulen auch Hersteller für Handys, Computerchips und Autoelektronik, wieder drei neue Kunden dazu gewonnen: Q-Cells übertrug im März 200 Megawatt seiner Modulproduktionskapazität an den asiatischen Fertigungsdienstleister und der Hersteller von Hochleistungszellen- und modulen Sunpower meldete im April, dass er 75 Megawatt seiner Solarmodulfertigung an das Unternehmen auslagern wird. Im Juni folgte schließlich Petra Solar und übergab die Produktion seiner so genannten Sunwave-Module ebenfalls an Flextronics. Der Trend, nach Fernost auszulagern, hält also weiter an. Es stellt sich die Frage, ob die Modulqualität darunter leidet.
In der Heimat auslagern
Doch nicht alle Solarunternehmen sind mit ihrer Modulfertigung gleich nach Fernost abgewandert. Der Photovoltaikkonzern Solon zum Beispiel hat innerhalb Deutschlands ausgelagert. Da die Produktionskapazitäten im Berliner Werk nicht mehr ausreichten, engagierte Solon den norddeutschen Fertigungsdienstleister ml&s in Greifswald. „Wir hätten auch unser Werk in Berlin erweitern können, aber 2003 waren die Politik und die Verwaltung in Berlin nicht so leichtgängig. In Greifswald gab es hingegen keine Probleme“, erklärt Therese Raatz aus der Finanzkommunikation von Solon. Nach China zu gehen, hätte sich nach ihren Aussagen nicht gelohnt, denn in der Modulproduktion machen die Personalkosten rund fünf Prozent aus. Das liegt zum einem an dem teuren Material, das einen Kostenanteil von bis zu 80 Prozent hat, und zum anderen an dem hoch automatisierten Produktionsprozess. „An der Personalschraube zu drehen, würde uns also nicht viel bringen“, sagt Raatz. Zudem spiele auch die Marktnähe eine Rolle und die sieht Solon in Deutschland und Europa. Es soll dort produziert werden, wo anschließend auch verkauft wird.
Die Vorteile des Outsourcings lassen sich hier gut wiedererkennen. Bevor ein Unternehmen selbst eine Produktionshalle erbaut und das Personal schulen muss, greift es auf einen Dienstleister zurück, der darin Übung hat. Die Produktion kann so schneller starten und das Unternehmen konzentriert sich derweil auf seine Kernkompetenzen, wie das Entwickeln und Vermarkten von Modulen. Aber nicht nur das technische Know-How, auch Subventionen können ein Anreiz sein, die Produktion an einen anderen Standort zu verlagern. Im Fall von Solon waren die politischen Rahmenbedingungen der Ausschlag dafür, die Produktion in Berlin nicht weiter auszubauen. So beeinflussen also auch Gesetze, Auflagen und Subventionen die Entscheidung der Unternehmer.
Risiken abgeben
Ein weiterer Grund fürs Outsourcing, egal ob Inland oder Ausland, sind die verteilten Risiken. Die schwankenden Produktionszahlen werden an den Dienstleister weitergegeben. Ist die Nachfrage an Solarmodulen geringer, stehen die Bänder in der Fremdfirma still. Das Solarunternehmen hat keinen Wartungsaufwand für die Maschinen und kein überflüssiges Personal. Im Wirtschaftsjargon heißt es, die Produktion könne dadurch atmen, sich also flexibel der Nachfrage anpassen. Udo Possin, Geschäftsführer von ml&s, nimmt diese Risiken trotzdem gerne auf sich: „Wir fertigen gleichzeitig für viele andere Branchen, wie Telekommunikation und Automobile. Die haben alle unterschiedliche Konjunkturzyklen, die sich gegenseitig ausgleichen.“ In den Sommermonaten, wenn weniger Photovoltaik gefragt ist, fertige er dafür mehr für die Telekommunikationsbranche.
Es klingt wie ein unternehmerischer Traum: Risiken und Produktionsaufwand abgeben und dafür ein fertiges Photovoltaikmodul zurückbekommen. Doch Kritiker meinen, Outsourcing lohne sich nur auf den ersten Blick. Stattdessen kämen erhöhte Transportkosten dazu, die Kommunikation mit einem fremden Unternehmen sei aufwändiger, besonders wenn die Sprache und Kultur eine andere ist. Auch die Qualität lasse sich nur schwer kontrollieren.
„Genau aus diesem Grund sollte Outsourcing immer kompetenzorientiert sein. Man sollte sich immer fragen: Kann ich das selbst besser machen?“, sagt Steffen Kinkel, Forschungsabteilungsleiter am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Wer die Frage verneinen muss, der sollte einem Drittunternehmer die Arbeit überlassen.
Wer hingegen nur auslagert, weil er den Kostenfaktor drücken will, kann schnell eine Überraschung erleben: Lieferantenprobleme, aufwändige Kommunikation und zusätzliche Kontrollkosten lassen die vermeintlich preiswerte Produktion schnell teuer werden. Erkenntnisse, die viele Unternehmen erst bitter lernen mussten.
Zurück wollen die wenigsten
In den 1990er Jahren und Anfang des Jahrtausends gab es einen regelrechten Hype ums Outsourcing, jeder wollte mitmachen. Nach vielen schlechten Erfahrungen hat sich die Herangehens weise heute geändert. Eine Auslagerung werde zunehmend strategischer angegangen und reflektierter betrachtet, sagt Kinkel.
Einen wirklichen Trend zum Backsourcing, dem Wiedereinlagern der Produktion, sieht er jedoch noch nicht. „Dass einige Unternehmen die Produktion wieder eingelagert haben, lag auch an der Wirtschaftskrise. Denn wenn meine eigenen Kapazitäten nicht mehr ausgelastet sind, hole ich mir die Produktion natürlich wieder zurück.“ Vor allem Branchen, die unter Preisdruck leiden, kommen selten zurück.
Doch man darf andere Industriezweige nicht mit der Modulfertigung gleichsetzen. So kompromisslos wie die Textilbranche kann es in der technischen Fertigung nicht zugehen. „Die Kleiderindustrie springt von einem Billiglohnland zum anderen. Da in China jetzt die Löhne steigen, wandern die Unternehmen in noch günstigere Länder in Asien wie Bangladesh oder Nepal ab – irgendwann wird es Afrika sein“, sagt der Münchner Professor Chaudhuri.
In der Modulproduktion wird geschultes Personal benötigt und technische Kompetenz. Der Standort ist daher nicht einfach austauschbar. Asien ist nicht nur wegen der Lohnkosten interessant, die aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs derzeit sogar steigen, sondern vor allem aus Marktgründen. Einerseits ist dort ein Großteil der Zellproduktion angesiedelt. Dadurch ergeben sich Beschaffungsvorteile bei den Zellen. Zweitens gibt es dort eine große Kaufkraft. Zudem hat sich der Markt in Asien zentralisiert, denn wo bereits andere Unternehmen sind, kann man die vorhandene Infrastruktur, das Personal, die Maschinen und das Knowhow nutzen. „Die mittlerweile große Erfahrung und Kompetenz in den Fertigungsprozessen ist zu einem wichtigen Standortfaktor geworden, der so manchen Lohnanstieg kompensiert“, sagt Chaudhuri.
Keine Antwort auf Qualitätsfrage
Doch bei allen unternehmerischen Vorteilen: Das Problem mit der Qualitätskontrolle bleibt, wenn man die Produktion in fremde Hände gibt. Um es in den Griff zu bekommen, sind die Unternehmen meist mit einer kleinen Mannschaft vor Ort. Auch Solon hat eigene Qualitätsprüfer in der Greifswalder Fabrik stationiert. Von der Galerie der Fertigungshalle aus sollen sie die Produktion ständig im Blick haben und streng auf die Umsetzung der Solon-Vorgaben achten. Um die Qualität weiter abzusichern, sind auch die Maschinen von Solon, ebenso das Material, aus dem die Module zusammengebaut werden. Die Prozesse laufen ab wie im Berliner Stammwerk. Possin verweist außerdem auf seinen Exklusivvertrag: „Wir fertigen ausschließlich für Solon. Es können also keine Modulbauteile verwechselt werden.“
Der Photovoltaikkonzern Q-Cells hat eine andere Entscheidung getroffen. Er lagert seine Modulproduktion auch aus, aber etwa 9.000 Kilometer weiter östlich - nach Malaysia. Das Unternehmen lässt seit Anfang des Jahres seine kristallinen Module beim Dienstleister Flextronics fertigen. Im Geschäftsbericht erklärt Q-Cells, dass der starke Umsatzrückgang bei Solarzellen das Unternehmen zwinge, sich anders auszurichten. Mit den neuen kristallinen Modulen wolle man den Marktzugang deutlich verbreitern. Eine eigene Modulfabrik aufzubauen, hätte für Q-Cells wohl einen größeren Zeitverzug bedeutet und zunächst hohe Investitionskosten. Da kam die Zusammenarbeit mit einem Fertigungsdienstleister wie Flextronics genau richtig.
Was die Qualität angeht, muss das nichts Schlechtes verheißen. Flextronics ist seit dreißig Jahren im Geschäft und hat nach eigenen Angaben viel Erfahrung in der Medizin- und der Luft- und Raumfahrtindustrie, die ebenfalls hohe Qualitätsstandards haben. Flextronics fertigt für mehrere Modulhersteller. Die Verantwortung für die Produktionsprozesse und deren Spezifikationen liegt hier beim Auftraggeber. Laut Ulrike Winter, Senior Manager Marketing und Strategic Business Development Europe bei Sanmina-SCI, einem großen EMS-Hersteller aus Kalifornien, kann man die Qualität durchaus sicherstellen. Dank Sanminas globalen Qualitätssicherungssystemen gebe es keinen Unterschied, ob man in Brasilien, China oder Thailand fertige. Das Unternehmen garantiere überall gleiche Produktionsbedingungen. Sanmina ist wie Flextronics und Jabil Circuits aus Florida erst vor kurzem in das Solargeschäft eingestiegen. Bei all den Parallelen zur Elektronik- und Halbleiterindustrie sollte man außerdem nicht vergessen, dass es auch große technologische Unterschiede gibt. Die lange Garantiezeit von zwanzig Jahren kennen nur Hersteller von Investitionsgütern und nicht die, die sonst zum Beispiel Handys fertigen.
Allerdings gibt es auch Outsourcing, bei dem der EMS-Hersteller gleichzeitig für andere Unternehmen produziert und unter eigenem Namen auftritt. Zum Beispiel JA Solar. Das Unternehmen fertigt sowohl Zellen für BP Solar als auch für sich selber. Ebenso AU Optronics, ein Flachbildschirmhersteller aus Thailand, der seine eigenen Module auf den Markt bringt und andere für Sunpower produziert.
Offshoring: der kleine Unterschied
Wichtig ist auch, Outsourcing nicht mit Offshoring zu verwechseln, bei dem zum Beispiel eine Niederlassung im Ausland gebaut wird. Nur, wenn eine Fremdfirma, die gesellschaftlich nicht mit dem Unternehmen zusammenhängt, die Produktion übernimmt, spricht man von Outsourcing. Solarworld zum Beispiel hat neben seiner Modulproduktion in Freiberg auch eine Fertigungshalle in Kalifornien eröffnet. Ein hundertprozentiges Tochterunternehmen ohne Fertigungsdienstleister. Also kein Outsourcing, sondern Offshoring.
„Wir lagern nicht an Fremdfirmen aus“, sagt Milan Nitzschke, Leiter für Marketing und Kommunikation, „somit haben wir die Kostensituation voll im Blick und können volle Produktqualität garantieren.“ In die USA sei man gegangen, weil sich dort ein wachsender Photovoltaikmarkt befinde. Hohe Transportkosten hätte man dadurch nicht, da man vor Ort für die amerikanischen Käufer produziere.
Neben den beiden Werken in Freiberg und Kalifornien hat Solarworld auch ein Joint Venture in Südkorea. Auch das ist eine Form von Offshoring, nicht von Outsourcing, denn Solarworld ist mit 50 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen
beteiligt. „Wir fertigen dort komplett nach unseren Standards auf den gleichen Maschinen“, sagt Nitzschke. Niedrige Lohnkosten hätten dabei keine Rolle gespielt. Südkorea sei verglichen mit dem Rest Asiens ein Hochlohnland. Man habe qualifiziertes Personal und die Nähe zu einem großen Markt gesucht.
Mehr Kontrolle, mehr Risiko
Offshoring bietet mehr Kontrolle, gleichzeitig ist das eigene Risiko höher, denn das Unternehmen haftet selbst für Schäden und Ausfälle. Und nicht immer ist das firmeneigene Offshoring nur von Idealen angetrieben. Tochtergesellschaften können auch gegründet werden, um geltende Tarif- oder Arbeitsverträge zu umgehen.
Jedes Unternehmen, das Outsourcing oder Offshoring betreibt, wird behaupten, dass die Qualität genau kontrolliert wird und nicht darunter leidet. Generell mag das stimmen. Die Elektronikbranche hat viel Erfahrung, EMS-Fabrikanten auf Standards festzulegen. Ob das auch im Einzelfall stimmt, ist nur schwer festzustellen. Es ist auch nicht einfach zu sagen, wer nur die Produktionskosten drücken will und wem tatsächlich die Möglichkeiten fehlen, die Module selber herzustellen. Viele der befragten Experten vermuten, dass Auslagerung noch immer oft auf der Kostenebene entschieden wird, anstatt sich nach der Kompetenz zu richten. Erst langfristig wird sich zeigen, wer die Outsourcing-Strategie richtig umgesetzt hat. Kurzfristig kann man Herstellern nur vertrauen oder eben nicht.