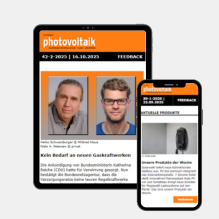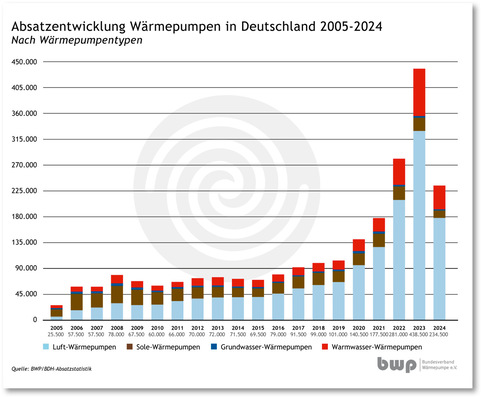Deutschland rühmt sich seineR Vorreiterrolle in der Energiewende. Doch die Realität sieht düster aus. Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch (Strom, Wärme und Mobilität) liegt seit vier Jahren bei mageren 20 bis 22 Prozent.
Wärme und Mobilität vernachlässigt
Das ist nicht nur unter dem EU-Durchschnitt (aktuell rund 25 Prozent), sondern vor allem ein Zeichen für kolossales Politikversagen. Denn während der Stromsektor, der ein Viertel des Bruttoendenergieverbrauchs ausmacht, inzwischen rund 60 Prozent erneuerbare Energie einsetzt, blieben Wärme und Mobilität – und damit drei Viertel des Bruttoendenergieverbrauchs – bislang weitgehend außen vor.
Das gilt nicht für hochgradig energieautarke Gebäude. Mit ihrer hohen Netzdienlichkeit stellen sie einen beachtlichen Teil der Lösung zur erfolgreichen Energiewende dar. Dennoch sind sie nicht im Fokus der Energie- und Wohnungsbaupolitik.
Gefährlicher Ungleichklang
So entstand ein gefährlicher Ungleichklang: Statt systematisch alle Sektoren zu dekarbonisieren und aufeinander abzustimmen, konzentrierte sich die Politik auf publikumstaugliche Solarmeldungen und Windkraftbilder. Doch das eigentliche Rückgrat der Energiewende – Speicher, Netze, Steuerung – blieb weitgehend unmodernisiert. Die Folge: ein technisch überfordertes Netz, steigendes Risiko für Stromausfälle und eine Bevölkerung, die sich zunehmend verschaukelt fühlt.
Aktuell wird erwartet, dass in weiten Teilen Deutschlands ab 2026 keine neuen Solarstromanlagen oder Schnellladesäulen für Elektroautos mehr ans Netz angeschlossen werden können. Neue Windkraft- und Solaranlagen sollen nur noch außerhalb der Einspeisespitzenzeiten einspeisen dürfen.
Das Stromnetz ist schlicht erschöpft. Die Ursache: Das vorhandene System, größtenteils aus den 1960er-Jahren, war nie dafür ausgelegt, volatile Stromquellen wie Sonne und Wind in solchen Größenordnungen aufzunehmen – geschweige denn zu steuern.
Kontrollverlust droht
Spätestens ab mehr als 60 Prozent fluktuierender Energie im Netz droht Kontrollverlust. Die Notfalleingriffe ins deutsche Stromnetz steigen seit Jahren: In den 2000er-Jahren waren es noch drei bis sechs Eingriffe pro Jahr, 2024 hingegen mussten die Übertragungsnetzbetreiber mehr als 15.000 Mal eingreifen!
Ohne ausreichende Energiespeicher, ausgebaute Trassen von Nord nach Süd und die smarte Steuerung von Erzeugern und Verbrauchern geraten Netzfrequenz und Lastverteilung aus dem Gleichgewicht. Die Gefahr des Blackouts ist real, und zwar völlig unabhängig von potenziellen Hackerangriffen, die in der öffentlichen Wahrnehmung bisher als einzige Ursache befürchtet werden.
Gleichzeitig wurden zahlreiche Grundlastkraftwerke bereits abgeschaltet. Neue flexible Kraftwerke entstehen kaum, da sie sich wirtschaftlich nicht rechnen.
Netzdienlich statt einspeisend
Die neue Währung der Energiewirtschaft heißt nicht mehr Einspeiseleistung, sondern Netzdienlichkeit. Im Grunde ist dies ein Paradoxon, da das Netz eigentlich seinen Bürgern und der Wirtschaft dienen soll und nicht umgekehrt.
Der Paradigmenwechsel ist aber unausweichlich: In einer Welt, in der alle zur gleichen Zeit Strom produzieren, wird Einspeisung zur Belastung. Und wer in solchen Momenten weiterhin einspeist, soll künftig sogar zahlen – eine radikale Umkehr des bisherigen Förderprinzips.
Das bedeutet konkret: Nur wer sich netzdienlich verhält – also Strom abnimmt, wenn Überschuss besteht, und Last reduziert, wenn Knappheit herrscht –, wird künftig belohnt. Das betrifft besonders Gebäude, die als systemrelevante Puffereinheiten agieren können.
Gebäude: vom Problem zur Lösung
Ein innovatives Gebäudekonzept sind hochgradig energieautarke Mehrfamilienhäuser mit Photovoltaik auf den Dächern und an Fassaden sowie drei Speicherebenen. Sie zeigen bereits heute, wie Wohnimmobilien aktiv zur Netzstabilisierung beitragen – und wirtschaftlich hochattraktiv bleiben:
Alle drei Technologien können auch über eine dezentrale Steuerung ineinandergreifen und intelligente Zähler nutzen, um auf Schwankungen von Preisen und Spannungen zu reagieren. Das Ergebnis ist ein hochgradig autarkes, flexibles, netzdienliches Gebäude.
Renditehebel für die Wohnungswirtschaft
Was bedeutet das für Investoren und Vermieter? Die Antwort ist klar: Netzdienliche Gebäude bieten nicht nur Sicherheit in unsicheren Energiezeiten, sondern eröffnen echte Renditechancen. Durch intelligente Lastverschiebung lassen sich Einkaufskosten für Strom drastisch senken – bei gleichzeitiger Reduktion der Nebenkostenpauschale für Mieter.
Zudem wird erwartet, dass Förderprogramme und regulatorische Erleichterungen künftig gezielt auf netzdienliche Lösungen zugeschnitten werden. Wer jetzt investiert, profitiert nicht nur von niedrigen Betriebs- und Verbrauchskosten, sondern auch vom entscheidenden strategischen Vorsprung gegenüber herkömmlichen Bestandsimmobilien.
Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Bauträger in Süddeutschland hat 2023 fünf hochgradig energieautarke Wohneinheiten mit netzdienlichen Technologien ausgestattet – darunter Batteriespeicher, Autarkieboiler und Infrarotheizungen. Die Gebäude wurden weitgehend solarisiert. Bereits im ersten Betriebsjahr sanken die Energiekosten um etwa 30 Prozent.
Die Bewohner profitieren von stabilen Pauschalmieten – trotz volatiler Märkte. Der Vermieter erzielt über Direktstromhandel und Netzentlastungsboni zusätzliche Einnahmen. Gleichzeitig funktioniert das hochgradig energieautarke Mehrfamilienhaus unabhängig von Engpässen oder Planungsstopps für neue Photovoltaikanlagen.
Soziale Entlastung
Kommunale und privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen können mit netzdienlichen Gebäuden stabile oder sogar sinkende Betriebskosten garantieren, selbst bei steigenden Energiepreisen. Das hat erhebliche positive soziale Auswirkungen, denn sie sichern bezahlbares Wohnen. Die Pauschalmiete, die sämtliche Kosten für Energie (Heizung, Strom, Warmwassererzeugung und zukünftig auch E-Mobilität) inkludiert, bedeutet nicht weniger als soziale Planungssicherheit.
Mieter werden unabhängig von Energiepreisschwankungen, was besonders einkommensschwächere Haushalte entlastet. Gleichzeitig bietet die eigene Stromerzeugung eine neue Ertragsquelle für Vermieter: Sie können überschüssigen Strom direkt vermarkten oder gegen Netzentgelte bonifizieren (Netzdienstleistungen oder Spitzenlastvermeidung).
Hohe Zusatzerlöse möglich
Das kann hohe Zusatzerlöse generieren. Eine hohe Eigenversorgungsquote von 50 bis 70 Prozent Autarkie ist kostengünstig erreichbar. Dadurch können Quartiere ohne Verzögerung realisiert werden, auch wenn die Anschlusskapazitäten am Netz begrenzt sind – sozusagen Sektorkopplung auf unterer Ebene.
Außerdem positionieren sich kommunale wie privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen mit netzdienlichen Gebäuden als Vorreiter. Das dient nicht dem Image, sondern sorgt auch für Effekte am Markt.
Energiewirtschaft am Scheideweg
Die Energiewirtschaft steht an einem Scheideweg. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nur die halbe Miete. Ohne netzdienliche Gebäude droht der Kollaps. Die Wohnungswirtschaft ist dabei nicht Opfer, sondern Schlüsselakteur.
Wer heute in netzdienliche Technologien investiert, schützt nicht nur seine Immobilienwerte, sondern sichert sich seine erfolgreiche Rolle in der Energiezukunft, mit Vorteilen bei Finanzierung, Förderung und Marktposition.
Denn die nächste große Regulierung kommt bestimmt, auch mit neu gewählter Bundesregierung. Und sie wird nicht Netzbelastung unterstützen, sondern diejenigen belohnen, die sich netzdienlich verhalten.
Niesky/Sachsen
Mehrfamilienhaus enttechnisiert und nahezu energieautark
Niesky liegt im sächsischen Landkreis Görlitz nahe der polnischen Grenze. In der Rosenstraße steht ein moderner Neubau, der ein kleines Sonnenkraftwerk ist. Das Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen produziert den Großteil seines Bedarfs an Wärme und Strom selbst. Ermöglicht wird dies durch großflächige Photovoltaik, Batteriespeicher, Infrarotheizung und dezentrale Autarkieboiler für Warmwasser.
Das Herzstück des Geschäftsmodells ist die Pauschalmiete: Statt der monatlichen Grundmiete plus Nebenkosten zahlen die Mieter einen festen Betrag, der alle Kosten für Wohnen, Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Glasfasernetz abdeckt. Jeder Stellplatz in der Tiefgarage verfügt über eine Ladebox fürs E-Auto.
Mindestens fünf Jahre lang bleibt die Miete dank dieser Energie-Flatrate stabil. „Wir schreiben die Miete zwischen 14 und 15 Euro pro Quadratmeter für fünf Jahre fest“, erklärt der Boxberger Bauunternehmer Matthias Schur, der gemeinsam mit seinem Bruder solche Häuser schlüsselfertig baut und vermietet. „Das bedeutet für den Mieter null Euro Nachzahlung und für uns Kostenersparnis, weil wir weniger Administration haben und keine Fremdfirmen mit dem Ablesen der Heizung beauftragen müssen.“
Der Verbrauchsdeckel sei sehr komfortabel, berechnet durch Mieterbefragungen. „So kann im Grunde jeder Mieter die Konditionen mitgestalten“, urteilt Schur. „Gleichzeitig werden die Mieter zu mehr Bewusstsein beim Nutzen elektrischer Geräte motiviert.“
Die Zahlen beeindrucken: Das Gebäude erreicht eine reale Autarkiequote von 60 Prozent. Von Mitte März bis Mitte Oktober läuft der Betrieb sogar nahezu vollständig unabhängig vom Stromnetz. In dieser Zeit stammt die gesamte Energie von der Sonne, erzeugt durch Solarmodule auf dem Dach, an Fassade und Balkonen (133,6 Kilowatt installierte Solarleistung).
Überschussstrom wird in Batteriespeichern zwischengespeichert. Er versorgt die Bewohner bei schlechtem Wetter oder in den Abendstunden. Der CO₂-Ausstoß während dieser autarken Phase: null. Selbst in den Wintermonaten ist der Zukauf aus dem Netz vergleichsweise gering, da das Gebäude dank seiner kompakten Bauweise und moderner Dämmung wenig Energie benötigt.
Ein weiteres Plus für Mieter und Vermieter: Das Gebäude ist netzdienlich ausgelegt. Es kann beispielsweise im Sommer nachts anstatt tagsüber überschüssige Solarenergie ins Netz einspeisen. Im Winter kann es mit preiswertem Windstrom den Akku günstig aufladen oder in Zeiten hoher Netzlast den Eigenverbrauch durch Abschalten der Infrarotheizung oder der Autarkieboiler drosseln.
Das spart enorme Kosten. Damit ist das Wohnhaus vorbereitet auf die Herausforderungen der Energiewende, in der flexible Verbraucher und Speicher eine immer größere Rolle spielen.
Im Vergleich zu üblichen Neubauten liegen die monatlichen Energiekosten für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom pro Wohnung bei nur 0,50 Euro pro Quadratmeter. Ein Spitzenwert. Für die Bewohner heißt das planbare, niedrige Wohnkosten und ein Beitrag zum Klimaschutz in einem.
Ein Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg ist die enttechnisierte Bauweise. Statt auf störanfällige wassergeführte Heizsysteme oder Wärmepumpen zu setzen, kommt das Haus ohne Rohrleitungen, Heizkreise und Pumpen aus. Die Infrarotheizungen werden elektrisch betrieben, sind wartungsfrei und halten etwa 30 Jahre.
Warmwasser wird in dezentralen Autarkieboilern in jeder Wohnung erzeugt. Der thermische Schutz vor Legionellen und zentrale Warmwasserspeicher entfallen.
Auch für die Schurs als Eigentümer bedeutet das Ersparnisse: geringere Investitionskosten, keine Wartungsverträge, weniger Reparaturbedarf und eine günstigere Versicherung fürs Gebäude. In Summe können sie als Vermieter zwei bis drei Euro pro Quadratmeter mehr Miete erzielen.
Zudem erhöht sich der Verkaufswert der Immobilie. Das dürfte Investoren aufhorchen lassen. Ab Oktober sind die Wohnungen bezugsfertig. „Wir merken jetzt schon in der Vermietung, dass die Entscheidung genau richtig war“, berichtet Matthias Schur. „Wir bauen nicht mehr anders!“
Die nächsten hochgradig energieautarken Mehrfamilienhäuser seien bereits geplant, in Weißwasser und in Bautzen. Die steigenden Anfragen von Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften bestärken die Schurs dabei.

Foto: Matthias Schur