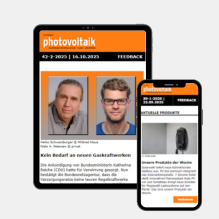Das C&I-Segment entwickelt sich nur langsam. Wie kommt dieser Markt bei Ihnen als Finanzdienstleister an?
Joachim Plesch: Die Nachfrage ist immens, es ist eine spannende Zeit. Wir spüren, dass die Unsicherheit bei vielen Unternehmen steigt. Sie wollen das Risiko der Investition in eine Eigenstromanlage nicht allein übernehmen. Also kommen sie zu uns. Denn wir finanzieren das Projekt und treten somit auch ins Risiko ein.
Wer spricht Sie konkret an, die Unternehmer oder Installateure, die für die Firmen Solaranlagen bauen?
Drei Viertel sind Installateure, deren Kunden die kapitalintensive Investition im Augenblick scheuen. Ungefähr ein Viertel der Anfragen kommt direkt von Unternehmern, meist institutionellen Eigentümern von Gewerbeimmobilien. Zwar wissen sie, dass sie mit Solarstrom ihre Energiekosten drücken können. Aber wie gesagt, sie scheuen das Risiko, selber zu investieren, und brauchen eine Lösung, die nicht viel Aufwand verursacht.
Warum werden ausgerechnet die Eigentümer von Immobilien aktiv?
Bis 2030 müssen sie nachweisen, dass sie Photovoltaik nutzen. Sonst werden die Immobilien gemäß der Taxonomie der EU beziehungsweise der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie abgewertet. Das erhöht den Druck, etwas zu tun.
Geht es bei Ihnen vor allem um einspeisende Anlagen oder auch um Gewerbespeicher?
Bisher haben wir C&I-Anlagen mit sehr hohem Eigenverbrauch finanziert, unter anderem mit der Option, Gewerbespeicher später nachzurüsten. Anlagen allein zur Einspeisung zu finanzieren, sogenannte Volleinspeiser, macht für uns keinen Sinn. Für uns sind nur Anlagen interessant, deren Sonnenstrom möglichst komplett im Unternehmen verbraucht wird.
Ist da der Speicher nicht ein Muss?
Wir bekommen viele Anfragen, wo der Sonnenstrom zu 80 oder 90 Prozent im Unternehmen verwendet wird, auch wenn kein Speicher integriert ist. Da lohnen sich Speicher oft nicht, da sie den Eigenverbrauch nicht mehr maßgeblich erhöhen. Allerdings gibt es auch Anlagen, die wir nun mit Gewerbespeichern planen, gerade wenn die Lastspitzen eher am Morgen oder Abend liegen. Freilich kann es andere Gründe geben, etwa Solarspitzen oder dynamische Stromtarife. Das wird zunehmen, dessen bin ich mir sicher.
Denkbar wären Gewerbespeicher, die ohne Photovoltaik wirtschaftlich sind …
Auch das wird wichtiger. Mit einem leistungsfähigen Speicher lassen sich ganz ohne Photovoltaik beispielsweise Lastspitzen verschieben, allein dadurch kann man ihn finanzieren. Durch dynamische Stromtarife werden die Gewerbespeicher immer wichtiger.
Welche Anlagengrößen finanzieren Sie meistens?
Viele unserer Anlagen leisten 99,9 Kilowatt, sie sind für kleinere Mittelständler interessant. Die Grenze von 100 Kilowatt ergibt sich aus der Grenze zur Direktvermarktung, denn ab dieser Leistung muss man die Anlagen entsprechend ausstatten und einen Vermarkter involvieren. Allein dieser Direktvermarktungsvertrag ist schon recht teuer. Das lohnt sich für die Unternehmen meistens nicht. Ihnen geht es ja darum, den Strom möglichst selbst zu verbrauchen.
Finanzieren Sie auch größere Anlagen?
Durchaus, zwischen 400 und 600 Kilowatt. Dann ist es wirtschaftlich darstellbar, die Direktvermarktung zu integrieren. Deshalb haben wir faktisch keine Anlagen zwischen 100 und 150 Kilowatt. Auch große Anlagen mit 600 Kilowatt sind für manche Firmen lukrativ, weil sie sehr viel Strom brauchen.
Wie viele Anlagen haben Sie 2024 finanziert? Wie viele werden es in diesem Jahr?
Zwischen 20 und 25 Anlagen. In diesem Jahr werden wir ungefähr dieselbe Zahl erreichen, allerdings sind die Anlagen mittlerweile viel größer.
Das Gros der Anfragen kommt über Installateure. Spüren Sie wachsendes Interesse für C&I-Projekte?
Das merken wir sehr stark bei den Installateuren, mit denen wir kooperieren. Die Nachfrage steigt, immer mehr Kunden wollen größere Anlagen bauen. Aber mittlerweile wird auch dort erwartet, dass Installateure eine Art der Finanzierung mitanbieten. Die Unternehmen kennen das vom Maschinenleasing und wollen das in unsicheren Zeiten auch bei der Photovoltaik sehen. Bei der Finanzierung von privaten Anlagen gibt es diesen Trend schon länger. Auch dort werden Finanzprodukte immer wichtiger, zumal die Banken ihre Kredite nur sehr zögerlich ausreichen.
Wie refinanzieren Sie die Investitionen?
In der Regel über PPA vor Ort, sogenannte On-site-PPA. Das sind Stromlieferverträge, die zudem eine Option für die Übernahme der Anlage ins Betriebsvermögen beinhalten. Wir übernehmen den Betrieb der Anlagen und treten der Firma gegenüber als Stromlieferant auf. Nach zehn Jahren kann die Firma dann die Anlage übernehmen, zum Zeitwert, der sich mit jedem Jahr verringert.
Woran erkennen Sie, ob ein Projekt finanzierbar ist?
Das erkennt man sehr schnell an der Qualität der Simulation, die den Eigenverbrauch im Unternehmen analysiert. In den gängigen Planungsprogrammen für Photovoltaikanlagen sind solche Simulationen machbar, wenn man damit etwas Erfahrung hat. Sie liefern uns ein erstes Indiz, ob der Installateur sein Fach versteht. Den Lastgang des Kunden wirklich zu kennen, ist der erste Schritt.
Mussten Sie schon Anfragen ablehnen?
Das kommt durchaus vor. Oft werden Angebote für Gewerbeanlagen erstellt, ohne dass der Ertrag und die Stromnutzung simuliert wurden. Dann können wir nicht tätig werden, denn die Finanzierung beruht auf den Stromerträgen und dem konkreten Eigenverbrauch des Endkunden. Manche Installateure haben bislang nur private Anlagen geplant und gebaut. Nun wollen sie beispielsweise mit einer 50-Kilowatt-Anlage ins Gewerbesegment einsteigen. Sie müssen beachten, dass die technischen und planerischen Anforderungen bei größeren Anlagen deutlich höher liegen.
Zum Beispiel?
Man muss nicht nur die Lastprofile kennen und wissen, wie man den Eigenverbrauch im Unternehmen optimiert. Gewerbeanlagen brauchen Wandlermessungen, ab 100 Kilowatt kommt die Pflicht zur Direktvermarktung und die Abschaltung durch den Netzbetreiber. Größere Anlagen brauchen Netzkuppler. Nicht zu vergessen die Zertifizierung.
Die Zertifizierung ist ab 270 Kilowatt vorgeschrieben. Wie gehen Sie damit um?
Die Anlagenzertifizierung nach VDE-AR-N 4105 bzw. VDE AR-N 4110 wird ab 270 Kilowatt auf der AC-Seite gefordert. Für Anlagen zwischen 270 und 500 Kilowatt gilt eine Sonderregelung, wenn der Eigenverbrauch über 50 Prozent liegt. Das ist bei unseren Anlagen immer der Fall. Dann braucht man keine Zertifizierung. Über 500 Kilowatt ist das Anlagenzertifikat in jedem Fall vorgeschrieben. Aber es gilt immer die AC-Leistung am Wechselrichter der Anlage als Maßstab.
Und die DC-Seite?
Sie ist für die Zertifizierung weniger relevant. Man kann also 600 Kilowatt Solarmodule bauen und über Wechselrichter mit 500 Kilowatt anschließen und betreiben. Bei modernen Wechselrichtern kann man die DC-Seite 20 Prozent größer auslegen als den AC-Anschluss, wenn die Anlage nicht direkt nach Süden ausgerichtet ist. Dann erreicht sie ohnehin nicht die Spitzenleistung. Für Eigenverbrauch sind Mittagsspitzen ohnehin ungünstig.
Nehmen Sie die Anlagen, die Sie finanzieren, ab? Kontrollieren Sie die Qualität?
Einige unserer Partner arbeiten schon länger mit uns zusammen. Bei ihnen können wir davon ausgehen, dass die Qualität der Installation stimmt. Bei neuen Partnern schauen wir uns die Anlage nach der Errichtung meist auch mit dem Kunden zusammen an, selbstverständlich. Auch den Netzanschluss und die Abnahme durch den Netzbetreiber begleiten wir. Denn die Finanzierung funktioniert nur, wenn die Anlagen ordentlich arbeiten. Wir übernehmen ja das Risiko.
Haben Sie schon Anlagen mit Anschluss zur Mittelspannung finanziert?
Bis 100 Kilowatt bleiben wir meist in der Niederspannung, das ist eigentlich Standard. Bei 400 oder 600 Kilowatt werden Anlagen in der Mittelspannung angeschlossen. Wir finanzieren auch Anlagen für Kliniken, die über Mittelspannung gehen.
Wie kommen Installateure mit Ihnen in Kontakt, die im Gewerbesegment tätig werden wollen?
Manchmal kommen Fachbetriebe mit ihrem Konzept zu uns. Wir schauen uns das gemeinsam an, und manchmal entwickeln wir das Konzept zusammen. Meistens wissen wir innerhalb einer Woche, ob die Anlage, wie sie geplant wurde, finanzierbar ist.
Wie schnell kann es von der Planung bis zur Inbetriebnahme gehen?
In einem Fall kam ein Installateur mit seinem Kunden zu uns, um eine Anlage mit 100 Kilowatt zu bauen. Innerhalb von einer Woche war die Finanzierung klar, die Verträge zwei Wochen später unterschrieben. Einen Monat später kam die Anlage aufs Dach, auch der Netzbetreiber spielte mit.
Wann dauert es länger?
Der Knackpunkt ist meistens die Zusage für den Netzanschluss. Und nicht selten gibt es Verzögerungen, weil die Netzbetreiber überfordert sind oder besondere Anforderungen haben. Unser längstes Projekt zog sich über ein Jahr hin.
Worum ging es dabei?
Das war das Solardach für eine Jugendherberge in Freiburg. Anfang 2023 kam der Installateur zu uns. Geplant waren 99,9 Kilowatt, 85 Prozent Eigenverbrauch. Eigentlich keine große Sache, der Vertrag zur Finanzierung war ziemlich schnell unterschrieben. Dann mussten wir zehn Monate auf die Netzanschlusszusage warten. Die Zusage kam im Oktober 2023. Danach haben wir die Anlage gebaut. Wegen der Witterung ging es nicht ganz fix, doch im März 2024 war die Anlage fertig. Aber dann …
Dann …?
Die Photovoltaikanlage wurde mit einem Blockheizkraftwerk verschaltet. Wir hatten das Messkonzept bereits mit dem BHKW geplant. Doch plötzlich stellte sich der Netzbetreiber quer, der das Konzept bereits abgesegnet hatte. Es dauerte weitere sechs Monate, bis wir den Netzbetreiber von seinem eigenen Messkonzept überzeugt hatten. Erst Ende September 2024 war die Sache ausgefochten. Offenbar saß dort ein Mitarbeiter, der das Projekt und das Messkonzept einfach nicht verstanden hat. So haben wir faktisch zwei Jahre verloren, zwei Sommer mit hohen Erträgen, bis die Anlage wirklich am Netz war.
Nehmen Sie derzeit neue Installateure und neue Projekte an?
Ja, natürlich. Dabei ist uns wichtig, dass es beim Installateur schon eine gewisse Historie mit Gewerbe- und Industriephotovoltaik gibt, und dass wir gute Planungsunterlagen bekommen. Installateure können sich gerne direkt bei uns melden. Sehr einfach ist es übrigens für Installateure, die für ihre Privatkunden bereits die Finanzierungsplattform von Golfstrom nutzen. Wir arbeiten eng mit Golfstrom zusammen. Dort kann man nicht nur private Anlagen für eine Finanzierungsanfrage einstellen. Wer größere Anlagen einstellt, wird zu uns geleitet. Dann melden wir uns.
Glauben Sie, dass der Finanzierungsbedarf für C&I-Projekte weiter wachsen wird?
Das ist bereits erkennbar. Aber die Installateure müssen beachten, dass C&I-Projekte langwieriger sind als Solaranlagen fürs Eigenheim. Der technische und kaufmännische Aufwand ist höher, da muss man mehr Zeit reinstecken. Am Ende ist die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Sie muss man darstellen, egal ob man einen Kunden überzeugen oder ein Projekt finanzieren will.
Das Gespräch führte Heiko Schwarzburger.