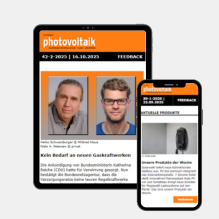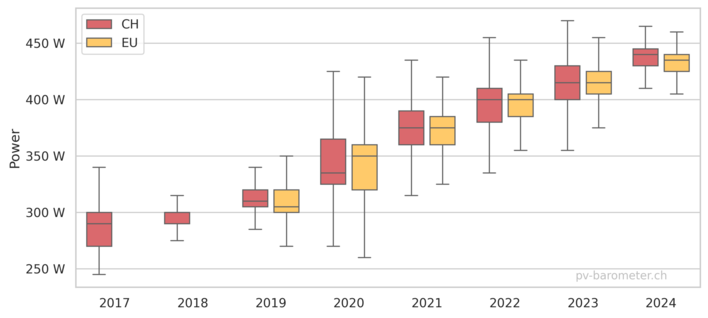Ein Elektroauto an die Ladesäule anstecken und den Strom aus dem Akku im Gebäude nutzen: Die Idee ist charmant. Doch funktioniert sie tatsächlich schon? Einige Projekte zeigen, dass das bidirektionale Laden sogar direkt am Stromnetz funktionieren kann. So hat der Münchner Anbieter von Ladeinfrastruktur The Mobility House vor einigen Monaten in Frankreich zusammen mit Renault ein solches Projekt ins Leben gerufen.
Schon im Jahr 2023 hat VW ein Projekt in Schweden gestartet, bei dem die Elektroautos ihren Strom für das Eigenheim bereitstellen. Dieser wird über das E3/DC-Hauskraftwerk von Hager Energy vom Auto in das Gebäude eingebunden. Technisch ist das bidirektionale Laden mittels Ladebox und Schnittstellen zwischen Fahrzeug und Ladepunkt fertig. „Doch das ist es nicht, was wir anstreben“, betont Stephan Hell. Er leitet das Solution Management für bidirektionales Laden bei Compleo Charging Solutions.
Ladestation muss Netzstandards erfüllen
Denn es geht nicht um proprietäre Einzellösungen. „Unser Ziel ist es, dass alle Elektrofahrzeuge mit den Wallboxen aller Hersteller und den Stromanbietern vollumfänglich die bidirektionalen Anwendungsfälle fahren können“, erklärt Hell. „Wenn sich der Haushalt dann ein zweites Elektroauto zulegt, das von einem anderen Hersteller kommt, muss das genauso funktionieren.“
Damit rückt die Ladesäule in den Mittelpunkt, wenn der gemeinsame Kommunikationsstandard von den Autoherstellern umgesetzt ist. Denn die Ladestation muss, wenn sie ins Netz einspeisen soll, die Regelungen gemäß VDE-AR-N 4105 für den Anschluss ans Niederspannungsnetz einhalten, wie jeder Wechselrichter einer Solaranlage. Das gilt auch, wenn das Auto über die Hauselektrik indirekt am Netzanschlusspunkt eines Gebäudes hängt.
Kosten gering halten
Einige Unklarheiten sind noch auszuräumen. So ist längst nicht geregelt, wie solch ein System zertifiziert und getestet werden muss, damit es wie ein Wechselrichter den Strom auch in hoher Qualität netzkonform bereitstellen kann. Es fehlen auch Regelungen, wie die Installateure geschult werden, und es ist offen, ob die Netzbetreiber in ganz Europa dies akzeptieren. „Schließlich wollen die Hersteller ihre Ladesysteme nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern verkaufen“, erklärt Stephan Hell.
Zusätzlich muss es darum gehen, die Kosten für die Ladeinfrastruktur so gering wie möglich zu halten. Deshalb kann nicht die gesamte Leistungselektronik allein in der Ladesäule verbaut werden. „Vielmehr gibt es Überlegungen, einfache AC-Wallboxen bidirektional nutzbar zu machen. Technisch geht das, aber regulatorisch ist das noch nicht ganz fertig“, ergänzt Hell.
Netz muss stabil bleiben
Dann müssen die Wallboxen nicht nur mit dem Auto kommunizieren können, sondern auch netzkonformen Wechselstrom bereitstellen, also wie ein Wechselrichter funktionieren. Technisch ist das schon ausgereift. „Was aber noch fehlt, ist das Zusammenspiel im Hintergrund: Wer steuert was? Wie wird zwischen dem Fahrzeugbesitzer, der Wallbox, den Energieversorgern und Aggregatoren kommuniziert? Es gibt noch viele offene Fragen“, weiß Stephan Hell. „Die Energieversorger sorgen sich etwa um die Netzstabilität – und das zu Recht. Die Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten müssen noch klar definiert werden.“
Dazu müssen wiederum entsprechende Standards definiert werden, die die Wallboxen und die Elektroautos erfüllen müssen, wenn sie bidirektional in ein Netz einspeisen wollen – in welches auch immer. Immerhin haben sich die potenziellen Partner beim bidirektionalen Laden, wie die Elektroindustrie und die Netzbetreiber in Deutschland, zusammengesetzt und Regelungen zu den Anforderungen an das bidirektionale Laden ausgearbeitet.
Technische Anforderungen erfüllen
So hat das Forum Netztechnik/Netzbetrieb des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE FNN) den Leitfaden für den „Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der VDE-AR-N 4105 für das bidirektionale Laden von Elektrofahrzeugen“ erstellt. Demnach besteht das System aus zwei verschiedenen Einheiten: dem Elektroauto und der Wallbox. Damit ist mindestens ein Teil des Gesamtsystems mobil und kann jederzeit durch ein anderes Modell ersetzt werden. Deshalb müssen alle möglichen Elektroautos, die an die Wallbox angeschlossen werden können, diese notwendigen Anforderungen nach VDE-AR-N 4105 erfüllen.
Der eigentliche Nachweis für die netzkonforme bidirektionale Ladefähigkeit muss über die Wallbox erbracht werden. „Dieser Teil ist dauerhaft mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz verbunden und muss daher vom Installateur gemäß den Anforderungen der VDE-AR-N 4105 und den Vorgaben aus den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Netzbetreibers parametriert werden“, gibt das VDE FNN vor. „Grundsätzlich regelt das Empfehlungspapier des VDE FNN, dass die Wallbox den Netzanschlussschutz übernimmt und das Auto die Frequenzregulierung, die Blindleistung und andere dynamische Netzparameter“, erklärt Stephan Hell. „Für uns als Compleo ist das praktisch. Denn wir entwickeln in der Kostal-Gruppe sowohl Onboard-Charger für das Elektroauto als auch die Wallbox.“
Deutschland und Schweiz als Vorreiter
Damit haben die Hersteller eine gewisse Sicherheit, was sie zertifizieren müssen, wenn sie in Deutschland Strom ins Netz einspeisen wollen. Auch in der Schweiz dürfen Autos nur bidirektional laden, wenn die Kombination aus Fahrzeug und Ladestation der „VSE-Empfehlung Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen (NA-EEA)“ und den technischen Normen für elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit entspricht. Dann kann das System nach Anmeldung vom Verteilnetzbetreiber bewilligt werden.
Auf europäischer Ebene fehlen solche Regelungen noch. Derzeit stockt der Abstimmungsprozess. Doch schon jetzt ist klar: Ohne einige Hardwareerweiterungen wird es nicht gehen – sowohl beim Auto als auch in der Ladesäule.
Strom aus dem Auto in den Speicher
Stephan Hell geht davon aus, dass die Ladesysteme in den Fahrzeugen der nächsten Generation wechselrichten können. „Dann kommt der andere Schwerpunkt: die Software, die für das bidirektionale Laden notwendig ist. Da geht es nicht mehr nur um die Kommunikation zwischen Auto und Wallbox, sondern um zusätzliche interne Erweiterungen“, erklärt er. „Denn die Wallboxen müssen dann unter anderem über eine Frequenz- und eine Spannungsmessung verfügen. Sie müssen dafür ertüchtigt werden, die Anschlussbedingungen und die Netzanschlussbedingungen der Netzbetreiber in den einzelnen Ländern zu unterstützen.“
Das gilt auch, wenn das Elektroauto ins Energiemanagement des Gebäudes eingebunden und als Speicher behandelt wird. Dies ist aufgrund der Verlustleistungen durch das Wechselrichten energetisch unwirtschaftlich. Denn dafür sind die Leistungen, die im Gebäude abgerufen werden, zu gering. Stephan Hell rät in einem solchen Fall, lieber den Strom aus dem Autoakku direkt in den Heimspeicher zu laden und das Haus vom Speicher aus zu versorgen.
Wenn das Auto über die Hauselektrik in das Verteilnetz einspeist, kommt noch eine weitere Herausforderung hinzu: Dann muss genau gemessen werden, welche Strommengen das Auto in das Hausnetz einspeist, die dort verbraucht werden oder ins Stromnetz fließen. Diese müssten von den Strommengen aus der Photovoltaikanlage und vor allem aus dem Netz abgegrenzt werden. Dies ist vor allem im Mehrfamilienhaus oder im Gewerbebetrieb eine Herausforderung, da es unter anderem steuer- und energiewirtschaftsrechtlich bisher noch unzureichend geregelt ist.
Zudem schließen die Regelungen aus dem Solarspitzengesetz die Einspeisung von Strom aus Fahrzeugspeichern explizit aus, während stationäre Speicher einspeisen dürfen. Der Speicherstrom gilt dann sogar als Solarstrom, wenn nachgewiesen wird, dass die Energie aus der Photovoltaikanlage kommt. Undurchsichtig wird es, wenn Strom aus den Autoakkus im Speicher landet und eingespeist wird. Hier muss der Gesetzgeber noch Klarheit schaffen, ob dieser Strom dann als Graustrom gilt oder wieder ganz anders behandelt wird.
https://www.compleo-charging.com/
SMA
Wallbox mit Schutz gegen Datendiebe
Der neue E-Charger von SMA unterstützt seit 1. August 2025 mit der Firmwareversion 2.05.x.R die Cybersicherheitsanforderungen gemäß europäischer Funkanlagenrichtlinie (Radio Equipment Directive – RED 2014/53/EU). Zusätzlich dazu erfüllt die Wallbox auch den Sicherheitsstandard gemäß ETSI EN 303 645. Mit der ETSI-Zertifizierung geht SMA bewusst über gesetzliche Anforderungen hinaus und stärkt den Datenschutz und die Cybersicherheit für Eigenheimbesitzer und Unternehmen, die die Ladestation einsetzen.
Außerdem eröffnet SMA mit der Firmwareversion 2.05.x.R den Nutzern die Möglichkeit, bis zu 20 E-Charger mittels des Kommunikationsstandards Modbus TCP über den SMA Data Manager zu überwachen. Dies funktioniert ähnlich wie beim Ladegerät für die gewerbliche E-Auto-Flotte EV Charger Business von SMA.
Die Wallbox kommt zudem mit viel Zubehör zum Kunden. So spendiert SMA ein mobiles AC-Ladekabel vom Typ 2 mit einer Länge von fünf, 7,5 oder zehn Metern und eine Halterung für das Ladekabel. Zusätzlich kann der Ladevorgang mittels RFID-Karten gestartet werden. Für die Installation auf Parkplätzen kann der Kunde auch noch eine Stele bekommen, mit der er die Wallbox in eine Ladesäule verwandeln kann. SMA hat Stelen für eine oder zwei Wallboxen im Portfolio. Die Wallbox kann verschiedene Lademodi verarbeiten und kommt mit dynamischen Stromtarifen zurecht. Hier arbeitet SMA mit dem Energieversorger Lichtblick zusammen.
https://sma.de
Foto: SMA
Sun2Wheel
Bidirektionale DC-Ladestation
Der Schweizer Hersteller Sun2Wheel hat bidirektionale DC-Ladestationen entwickelt, die mit den Netzanschlussbedingungen in der Schweiz kompatibel sind. Mit ihnen können Elektroautos von Honda, Mitsubishi und Nissan ge- und entladen werden. Die Wallboxen haben eine Lade- und Entladeleistung von zehn Kilowatt und werden mit einem standardisierten CEE-Stecker an das Gebäude angebunden. Neu ist auch eine bidirektionale DC-Wallbox mit einer Ladeleistung von bis zu 22 Kilowatt. Die Entladung erfolgt mit bis zu 20 Kilowatt Leistung.
Die Ladestationen nutzen den Wechselstrom aus dem Gebäude und wandeln ihn in Gleichstrom um, der direkt in die Autobatterie fließt. Beim Entladen der Fahrzeugbatterie wird der Gleichstrom wieder in netzkonformen Wechselstrom umgewandelt und dreiphasig ins Gebäudenetz eingespeist. Die Ladelösung erfüllt die Anforderungen der DIN SPEC 70121 und ISO 15118-2 für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule. Sie ist auch als kombinierte AC/DC-Schnittstelle für Fahrzeugsteckvorrichtungen nach Plug IEC 62196-3 zertifiziert.
Die Wallboxen werden komplett in der Schweiz hergestellt und sind wahlweise mit einem Chademo- oder einem CCS-Anschluss lieferbar. Für die bidirektionale Nutzung ist zusätzlich der V2X-Controller notwendig. Dies ist eine Software, mit der die Hauseigentümer oder Gewerbetreibenden ihre Energieflüsse lokal steuern. Sie ist bereits auf jeder Ladestation von Sun2Wheel installiert und kann einfach in Betrieb genommen werden.
https://sun2wheel.com
Foto: Sun2Wheel