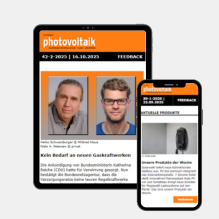Eines der zentralen Ergebnisse des Monitoringberichts zur Energiewende ist: „Der Ausbau der erneuerbaren Energieanlagen ist weiterhin in hohem Umfang notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.“ Grundlage ist ein stark ansteigender Strombedarf, den die Autoren vom Energiewirtschaftlichen Institut der Uni Köln und BET Consulting ermittelt haben. Sie gehen davon aus, dass der Strombedarf bis 2030 auf Werte zwischen 600 und 700 Terawattstunden pro Jahr ansteigen wird, und haben damit den Bedarf erwartungsgemäß kleingerechnet. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag der Stromverbrauch in Deutschland bei 511 Terawattstunden.
Sicherlich besteht Unsicherheit bezüglich der Geschwindigkeit des Anstiegs des Strombedarfs. Zuletzt ist er weniger stark angestiegen als erwartet, aufgrund der verschleppten Energiewende im Heizungskeller und des verzögerten Hochlaufs der Elektromobilität. Allerdings geht auch die Bundesnetzagentur beim Netzentwicklungsplan nur von 635 Terawattstunden aus. Sollte der Strombedarf doch schneller steigen, etwa aufgrund des Umstiegs auf elektrische Wärmeerzeuger und Elektroautos, bleibt das Netz auch in Zukunft das Nadelöhr der Energiewende, wenn dessen Ausbau und Ertüchtigung durch geringere Zielmarken künstlich gebremst werden.
Transportwege nicht berücksichtigt
Die Autoren des Berichts legen vor allem Wert auf sinkende Kosten für die Verbraucher. Dies soll aber nicht allein mit preiswerten Erneuerbaren in Kombination mit Speichern und Flexibilitäten geschehen, sondern auch durch teure Gaskraftwerke. Zudem soll die Energiewende zentraler werden. Der Ausbau solle in Zukunft stärker auf den Bau von Solarparks statt auf solare Dachanlagen gesetzt werden. Dies würde neue Belastungen für das Netz bedeuten, weil der Strom von den Solarparks viel weiter transportiert werden muss, als wenn er dort erzeugt wird, wo die Verbraucher ihn benötigen.
Neue Verbrauchskonzepte ignoriert
Sie verweisen hier auf die Kosteneffizienz der Freiflächenanlagen. Tatsächlich liegen die Kosten für Solarparks 31 bis 47 Prozent niedriger als bei kleinen Aufdachanlagen, wie das Fraunhofer ISE ausgerechnet hat. Doch übersehen die Autoren hier die Potenziale, die eine verbrauchernahe Erzeugung in Kombination mit Konzepten wie dem Energy Sharing bieten. Denn damit werden größere Strommengen direkt innerhalb von kleinen räumlichen Strukturen genutzt, was die Notwendigkeit des überregionalen Netzausbaus verringert.
BSW-Solar fordert Überarbeitung des Berichts zur Versorgungssicherheit
Zumal die Autoren die Chancen anerkennen, die sich mit der kombinierten Nutzung von markt- und netzdienlichen Flexibilitäten auf der Einspeise- und der Nachfrageseite ergeben. Sie sehen, dass diese zur Verringerung des Netzausbaubedarfs sowie zur Steigerung der netzseitigen Versorgungssicherheit, der Systemstabilität und der Reduzierung der Systemkosten beitragen können.
Kapazitätsmechanismus für Gaskraftwerke
Dazu müsse aber der Ausbau von Smart Metern und von Flexibilitäten sowie die Digitalisierung endlich viel schneller gehen. Die Autoren nennen hier auch noch den Ausbau von gesicherter Leistung, womit sie auf den Zubau von Gaskraftwerken anspielen. Da diese sich niemals marktorientiert finanzieren lassen, was wiederum von den Erneuerbaren verlangt wird, sollte ein Kapazitätsmechanismus entwickelt werden, bei dem das Vorhalten von Erzeugungskapazitäten vergütet wird. In diesen sollen in Zukunft auch Biogasanlagen einbezogen werden. Sie sollen nicht mehr als Grundlastkraftwerke im System arbeiten, sondern Spitzenlasten abdecken.
Eigenverbrauch ignoriert
Außerdem seien die kleinen solaren Dachanlagen nicht steuerbar und würden nach Angaben der Autoren des Energiemonitorings den notwendigen Ausbau des Verteilnetzes erhöhen. Auch hier werden die Möglichkeiten des Eigenverbrauchs etwa innerhalb von städtischen Quartieren vollkommen ignoriert. Denn diese sind rechtlich bisher nicht möglich und konnten so auch gar nicht mit in die Berechnungen der notwendigen Redispatchmengen einfließen.
Neue Studie zeigt: Deutschland braucht mehr Ökostrom
Kleine Anlagen sollen direkt vermarkten
Stattdessen schlagen die Autoren vor, die Fernsteuerung der Anlagen und die Pflicht zur Direktvermarktung auch auf Solargeneratoren auszuweiten. Bisher gilt dies nur für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 Kilowatt. Dies wird aber derzeit ohnehin nicht funktionieren. Denn dazu sind wiederum die beschleunigte Einführung von Smart Metern und standardisierte Kommunikationsschnittstellen notwendig. Zudem muss dafür auch der Ausbau der digitalen Netz- und Marktinfrastrukturen notwendig sein, damit die Netzbetreiber überhaupt in der Lage sind, die Preissignale zu übermitteln und die Fernsteuerung der Anlagen umzusetzen.
Speicher mit Ökostromanlagen kombinieren
Die Systemdienlichkeit steht bei Speichern im Mittelpunkt. Die Autoren plädieren hier unter anderem für die Co-Location von Speichern in Kombination mit Erzeugungsanlagen, sodass das Zwischenlagern des Ökostroms nicht selbst die Netze belastet. Außerdem sollten sie im Redispatch eingesetzt werden, da sie so konventionelle Kraftwerke einsparen können. Um dies zu steuern, schlagen sie höhere Baukostenzuschüsse vor, wenn die Speicher in Regionen mit einer höheren Netzauslastung gebaut werden. Werden sie in Regionen errichtet, wo noch freie Netzkapazitäten sind, sollten die Baukostenzuschüsse geringer ausfallen.
Ratgeber 2025: 250 Tipps für solaren Eigenstrom
Baukostenzuschüsse bleiben
Dies kann zwar den Bau von netzdienlich statt marktgetrieben gefahrenen Speichern steuern. Doch auf die Idee, auf Baukostenzuschüsse zu verzichten, wenn die Speicher Netzausbau einsparen, kommen die Autoren genauso wenig wie auf eine Differenzierung bezüglich des Speicherbaus in Regionen mit hoher Netzauslastung. Denn gerade dort können die Speicher für Entlastung sorgen, wenn sie in Kombination mit einer Solar- oder Windkraftanlage gebaut werden. Dies wird aber nicht geschehen, wenn sie mit hohen Baukostenzuschüssen konfrontiert sind.
Ausbau steuern
Eine ähnliche Steuerung des Zubaus wird auch für Solaranlagen vorgeschlagen. Auch hier plädiert man dafür, dass diese mit einer hohen Beteiligung am Netzausbau bestraft werden, wenn sie in Regionen mit hoher Netzauslastung errichtet werden. Dort, wo noch freie Kapazitäten sind, sollten die Baukostenzuschüsse niedriger sein. Zudem plädieren die Autoren dafür, endlich die Überbauung der Netzanschlüsse zuzulassen. Schließlich wird die Maximalleistung ohnehin nur selten erreicht und in diesem Falle könnten mehr Solarparks mit Speichern kombiniert werden.
Den kompletten Monitoringbericht finden Sie auf der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums. (su)