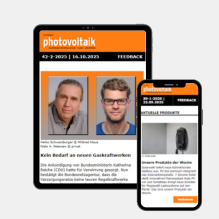Rund 450 Teilnehmer aus der Solarindustrie, Landwirtschaft und Forschung sind in das sonnige Freiburg im Breisgau gekommen, um die neuesten Entwicklungen rund um die Agriphotovoltaik kennenzulernen. Bereits zum sechsten Mal organisiert Connexio-PSE das internationale Agri-PV-Treffen – in diesem Jahr in der Schwarzwaldstadt, die auch das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) beherbergt.
Agri-PV war schon 1981 bekannt
Die Wahl des Ortes ist nicht zufällig. Denn das Fraunhofer ISE ist einer der Vorreiter bei der Entwicklung von Lösungen und Ideen zur Doppelnutzung von Landwirtschaftsflächen für die Nahrungsmittel- und Energieproduktion, wie Institutsleiter Andreas Bett betont. Er erinnert daran, dass schon Institutsgründer Adolf Götzberger im Jahr 1981 den ersten Ansatz zum Thema veröffentlicht hat. „Dies war damals eine echte Vision“, sagt Andreas Bett. „Nur wenige Menschen haben damals an solche Ansätze gedacht.“
Vorreiter der Agri-PV-Forschung
Andreas Bett verweist darauf, dass das Fraunhofer ISE die erste Agri-PV-Testanlage damals in Hegelbach errichtet hat, um die ersonnenen Möglichkeiten in der Praxis zu testen. Inzwischen sind schon viele solche Anlagen gebaut. Doch die Forschung ist immer noch notwendig. Denn die Landwirte, die sich für solche Lösungen interessieren, müssen kalkulieren können, welche Auswirkungen die Agri-PV auf die landwirtschaftlichen Erträge hat.
Sonnenstrom von Acker und Scheune: Unser Spezial für die doppelte Ernte in Agrarbetrieben
Stimmen die Ertragsversprechen?
Hier entspann sich auf dem Podium eine heftige Diskussion. „Wir müssen auch die Seite der Landwirte sehen. Denn mit der Agri-PV machen wir ihnen ein Versprechen, dass die Landwirte eine Steigerung ihres Einkommens erzielen. Das ist sehr attraktiv. Doch stimmt das auch?“, fragt Christian Dupraz vom National Research Insitute for Agriculture, Food and Environment (INRAE) mit Sitz in Paris, provokant. „Sind diese Mehrerträge ein durchschnittlicher Wert oder passiert das nur einmal alle zehn Jahre?“
Referenzböden schonen
Er sieht unter anderem das Problem bei den Kontrollflächen, die in Testinstallationen als Vergleich für Erträge ohne Solaranlage fungieren. „Doch während des Baus der Agri-PV-Testanlage wird oft auf dieser Fläche das Material gelagert, sodass diese Böden zunächst zerstört sind“, sagt Christian Dupraz. „Dann ist es nicht verwunderlich, dass die Erträge auf diesen Böden schlechter sind als unter den Solarmodulen“, erklärt er mit Blick auf einen möglichen Fehler bei den Untersuchungen.
Agri-PV: Eine Chance für den Betriebsübergang in der Landwirtschaft
Eine Gewinnspanne angeben
Es ist also mehr Forschung und ehrliche Forschung notwendig. Aus dem Publikum kam allerdings ein Hinweis, dass es schon sehr viele Ergebnisse gibt. Zahlreiche Untersuchungen wurden hinsichtlich des Pflanzenwachstums angestellt. Später kamen dann die Solaranlagen hinzu. Alle Effekte wurden untersucht – von der Auswirkung auf die Photosynthese durch die Verschattung bis zum Schutz der Pflanzen angesichts des fortschreitenden Klimawandels. Die Forscher, die sich mit den Themen beschäftigen, können den Landwirten eine Spanne über die Auswirkungen der Photovoltaik auf die Erträge nennen. Selbst seitens der Agrarforschung kann niemand einen konkreten Ertrag für eine Fläche nennen.
Dennoch zeigen die auf der Konferenz präsentierten Forschungsergebnisse in eine interessante Richtung. Wie die aktuellen Resultate einer Forschungsanlage über Apfelbäumen in Baden-Württemberg ausgefallen sind, erfahren Sie im nächsten Teil unserer Serie zur Agrivoltaics World Conference 2025 in Freiburg, der morgen erscheint.