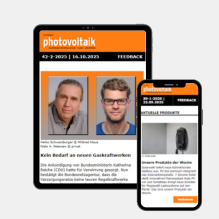Dass die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen in entscheidendem Maße davon abhängt, die Folgen des Klimawandels möglichst gering zu halten, ist heutzutage kein Geheimwissen mehr. Ebenso wenig dürfte umstritten sein, dass die Solarstromerzeugung weltweit und auch in Deutschland einen entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, dieses Ziel zu erreichen.
Daher ist es auf den ersten Blick umso überraschender, wenn bei der Planung von Photovoltaikanlagen immer wieder Zielkonflikte zwischen Solarenergie und Naturschutz aufgelöst werden müssen.
Schwer überschaubare Regeln
Hintergrund sind zahlreiche kleinteilige und schwer überschaubare Regelungen, welche das deutsche Naturschutzrecht kennt. Eine besondere Rolle spielt der Naturschutz immer dann, wenn besondere Gebiete ausgewiesen sind, in denen jegliche Art von Eingriffen besonders gerechtfertigt werden muss.
Hierzu gehören zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete. Sie sind keinesfalls seltene Ausnahmen. In Deutschland gibt es fast 9.000 Landschaftsschutzgebiete, die eine Gesamtfläche von über zehn Millionen Hektar aufweisen.
Sie erstrecken sich auf rund 27 Prozent der Fläche Deutschlands. Wer Photovoltaikprojekte plant, tut gut daran, sich bereits zu Beginn über mögliche Kollisionen mit dem Naturschutzrecht kundig zu machen.
In einem Fall, der dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Halle vom 10. Januar 2025 (Aktenzeichen 4 B 296/24 HAL) zugrunde lag, ging es um die Feinheiten eines solchen Zielkonflikts zwischen Photovoltaik und Naturschutz.
Ein Projektierer plante die Errichtung einer Agri-PV-Anlage. Der Bebauungsplan umfasste auch Teile des Landschaftsschutzgebiets „Größter Berge“ in Sachsen-Anhalt. Dabei waren nur 4,5 Prozent des Schutzgebietes vom Bebauungsplan betroffen. Der Projektierer erhielt die Baugenehmigung für seine Anlage. In diesem Zusammenhang wurde er auch von naturschutzrechtlichen Verboten befreit, die sich aus der einschlägigen Verordnung zum Landschaftsschutz ergaben.
Gegen diese Befreiung wurde von einem Gegner des geplanten Solarparks das Verwaltungsgericht angerufen. Unter anderem ging es darum, ob bei der behördlichen Entscheidung ausreichend berücksichtigt wurde, dass die Photovoltaikanlage eine Gefährdung für Feldhamster in der näheren Umgebung darstellen könnte. Rechtlicher Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung war Paragraf 67 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Demnach können Befreiungen von den naturschutzrechtlichen Regelungen erteilt werden, wenn „dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist“.
Feldhamster gefährdet
Damit diese Regelung zur Anwendung kommen könne, müsse – so die Richter des Verwaltungsgerichts – ein atypischer Sonderfall vorliegen. Dieser atypische Sonderfall ergebe sich daraus, dass die Förderung der erneuerbaren Energien unter den besonderen Schutz des Gesetzgebers gestellt worden ist. Als das betroffene Landschaftsschutzgebiet in Sachsen-Anhalt 1998 geschaffen wurde, spielte der Klimaschutz noch keine besondere Rolle, argumentierten die Richter.
Was hat Vorrang?
Gemäß Paragraf 67 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG wägte das Gericht die Gründe eines überwiegenden öffentlichen Interesses für den Bau der Photovoltaikanlage mit den Gründen des Naturschutzes ab. Der Ausbau der erneuerbaren Energien liege im überragenden öffentlichen Interesse, führten die Richter aus. Dies ergebe sich nicht zuletzt aus Paragraf 2 Absatz 1 des EEG.
Das bedeute zwar nicht, dass der Naturschutz automatisch hinter das Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien zurücktrete. Denn das allgemeine Interesse am Ausbau regenerativer Energien begründe keinen allgemeinen Vorrang vor dem Landschaftsschutz. Insbesondere ist es nach Auffassung der Verwaltungsrichter nicht geeignet, Landschaftsschutzgebietssatzungen und die mit ihnen verfolgten Ziele im Wege der Befreiung generell zugunsten von energiepolitischen Zwecken zu relativieren. Umgekehrt sei es jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich die Solarenergie in besonders gelagerten Fällen gegenüber dem Landschaftsschutz durchsetzt, wenn die Landschaft am vorgesehenen Standort weniger schutzwürdig, die Beeinträchtigung geringfügig ist und die unter besonderen Schutz gestellten Ziele für die Landschaft nicht beeinträchtigt werden. Am geplanten Standort sei die Beeinträchtigung durch das Vorhaben gering. Das Vorhaben betreffe nur einen kleinen Teil des Landschaftsschutzgebiets.
Der Schutzzweck des Gebiets werde auch nur in geringem Maße beeinträchtigt. Erhebliche Auswirkungen auf den Landschaftsschutz seien nicht zu befürchten. Selbst die mögliche Gefährdung von Feldhamstern konnte das Gericht nicht umstimmen. Das Gericht bescheinigte der zuständigen Genehmigungsbehörde, keine Fehler gemacht zu haben.
Kein unüberbrückbarer Gegensatz
Insgesamt zeigt die Entscheidung, dass der von der alten Bundesregierung definierte Abwägungsvorrang für erneuerbare Energie gemäß Paragraf 2 Absatz 1 des EEG tatsächlich seine gewünschte Wirkung entfaltet. Projektierer haben es dadurch leichter, in Planungsverfahren zügig die notwendigen Befreiungen erteilt zu bekommen, die auch gerichtlichen Entscheidungen standhalten. Den Richtern in Halle ist zu danken, bei der Interessenabwägung berücksichtigt zu haben, dass Photovoltaik und Naturschutz keinen unüberbrückbaren Gegensatz darstellen.•
Solarparks
Mehr Pflanzen und Tiere auf früheren Äckern
Wenn ehemals intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Photovoltaikanlagen bebaut werden, nimmt die Biodiversität rasant zu. Das ist das Ergebnis einer Studie des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft (BNE). Dazu haben sich die Autoren die Artenvielfalt in 30 Solarparks in Deutschland und Dänemark angeschaut. Von April bis September 2024 kartierten sie acht Artengruppen, darunter Vögel, Amphibien, Tagfalter, Fledermäuse und Pflanzen. Im Unterschied zu vorherigen Studien haben sie sich nicht auf Konversionsflächen konzentriert, sondern auf einstige Äcker. Sie gingen der Frage nach, wie schnell sich die Artenvielfalt regeneriert. „In den vergangenen Jahrzehnten ist im Agrarraum viel Biodiversität verloren gegangen, zum Teil in dramatischem Ausmaß“, sagt Tim Peschel, einer der Autoren. Zusammen mit Rolf Peschel wies er nach, dass sich die Flächen durch die Solaranlagen beruhigen und neues Leben entwickeln. „Im Kontrast zur Agrarlandschaft sind im Solarpark verschiedene Strukturen wie Wege oder feuchte Bereiche unter den Modulen vorhanden“, erklärt Tim Peschel. „Auch wenn rundherum alles vertrocknet ist, blühen im Schatten noch Pflanzen. Sie bilden die Grundlage für die Ansiedlung von Insekten.“ Die Insekten wiederum bieten Nahrung für Vögel, Fledermäuse und Amphibien. So entwickeln sich die Solaranlagen zu artenreichen Inseln in der intensiv genutzten Agrarlandschaft. Bei ihrer Untersuchung der Flächen haben die Autoren der Studie beispielsweise 385 Pflanzenarten gefunden, die in der Umgebung nicht mehr vorhanden waren. Sehr seltene Arten konnten sich vermehren. Auch entwickeln sich über längere Zeiträume immer mehr Arten. Dies gilt auch für Tiere. So fanden die Wissenschaftler 13 von 79 in Deutschland ansässigen Libellenarten. Eine vom Aussterben bedrohte Art baut im Solarpark derzeit eine große Population auf. Außerdem haben die Forscher in den Solarparks 37 Prozent der in Deutschland ansässigen Heuschreckenarten und 17 Prozent der Tagfalterarten gefunden. Auch bei den Amphibien ist der Bestand bemerkenswert: Immerhin ein Drittel der heimischen Arten wurde beobachtet. Zudem fanden sich viele Eidechsen.
Insgesamt wurden 32 Vogelarten in den Solarparks gezählt, darunter gefährdete Arten wie die Feldlerche. Sie besiedelt immerhin drei Viertel der untersuchten Solarparks. In einem Fall wurde sogar der vom Aussterben bedrohte Steinschmätzer gesichtet. Fledermäuse – zum großen Teil bedrohte Arten – konnten die Autoren gleichfalls nachweisen. Bisher galt die vorherrschende Meinung, dass Solarparks Vögel oder Fledermäuse verdrängen. Deshalb wurden von den Projektierern spezielle Ausgleichsmaßnahmen gefordert. „Bei entsprechender Pflege ist das Gegenteil der Fall“, analysiert Rolf Peschel. „Die Tiere suchen so dringend neue Lebensräume, dass sie sich sofort im Solarpark ansiedeln.“ Teilweise wandern die Tiere schon während der Installation in die Fläche ein. Die Studie Artenvielfalt im Solarpark inklusive Hinweise zur Planung von Solaranlagen finden Sie auf der Internetseite des BNE zum Download: