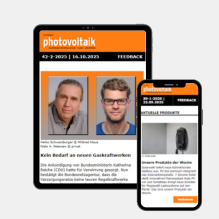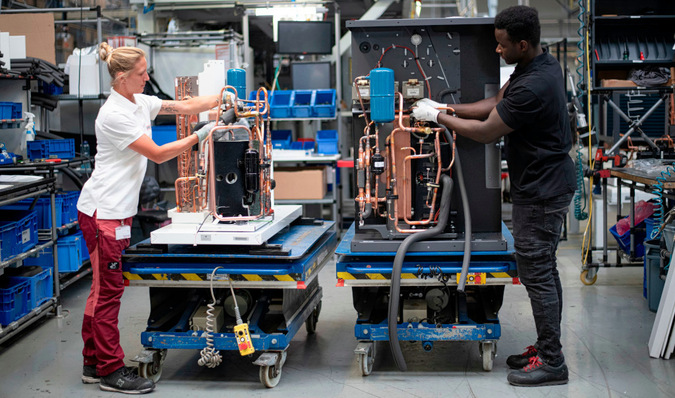Infrarotheizungen (IR) entwickeln sich zunehmend aus der Nische zur Standardtechnologie im Heizungsmarkt. Sie können Einfamilienhäuser und Mehrgeschosser zu teils erstaunlich niedrigen Energiekosten heizen – vor allem im Zusammenspiel mit Photovoltaik. Durch neue Geschäftsmodelle bieten sie höhere Mietrenditen. Das waren die zentralen Ergebnisse der diesjährigen Fachkonferenz, die im Frühjahr in Würzburg stattfand.
Zahlreiche Beispiele aus Neubau und Sanierung belegten die Sprünge, die diese Technologie in den vergangenen Jahren gemeistert hat. Allerdings verhindern vor allem regulatorische Hürden, dass das volle Potenzial von IR-Heizungen für bezahlbares Bauen und Wohnen voll ausgeschöpft werden kann.
Das Thema zieht Kreise
Eingeladen hatte der Branchenverband IG Infrarot Deutschland. Die jährliche Veranstaltung in Würzburg wird vom Runden Tisch begleitet, an dem sich auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Immobilienwirtschaft, Gebäudeenergieberatung und dem Handwerk treffen. Erstmals waren Sprecher der Wohnungswirtschaft und der Politik vertreten. „Wir sind mehr als Heizungsersatz im Hobbyraum“, betonte Lars Keussen, erster Vorsitzender des IG Infrarot Deutschland.
In seinem Eröffnungsvortrag demonstrierte er das neue Selbstbewusstsein der Branche: „Wir bieten Systeme für klimaneutrale, effiziente Gebäude und bezahlbare Wärme an.“ Im Sinne einer „echten Technologieoffenheit“ plädierte Lars Keussen dafür, dass das Ziel des Förderregimes smarte und bezahlbare Lösungen sein sollten anstelle einer „eher einseitigen Förderung“. Infrarotheizungen sind schnell und einfach zu installieren, wartungsfrei und langlebig. Und sie lassen sich gut mit Photovoltaikanlagen und Stromspeichern kombinieren.
Berechnung gemäß GEG
Für Stromdirektheizungen, zu denen Infrarotheizungen zählen, gilt das GEG (Heizungsgesetz). Paragraf 71d gibt vor, dass Heizungen künftig mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen,
Die Rechenregel zur Umsetzung dieser Vorgabe floss zwischenzeitlich in die Normung ein. Vom DIN-Verlag wurde die „Berechnung der Anteile erneuerbarer Energien nach der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes 2024“ veröffentlicht.
Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz ist Geschäftsführer des Instituts für Technische Gebäudeausrüstung (ITG) in Dresden. Er konstatierte, dass IR-Heizungen in zentralen Normen und Förderprogrammen bislang nicht ausreichend behandelt werden. Vor allem in der DIN V 18599 werde diese Heiztechnik nur unzureichend berücksichtigt. Das führe zu einer systematischen Benachteiligung dieser Technik.
Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringe Kosten
In seinem Vortrag definierte Oschatz aber auch Faktoren, die positiv für Infrarotheizungen wirken. So rücke die EPBD-Richtlinie der EU die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund. EPBD steht für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Energy Performance of Buildings Directive). Durch vergleichsweise niedrige Kosten für die Investition, die Montage und die Wartung können Infrarotheizungen punkten.
Mit Blick auf die Emissionen sind Infrarotsysteme im Vorteil, weil sie relativ wenig Material und Komponenten brauchen. Dies reduziere die graue Energie, also den Energieeinsatz von der Fertigung über den Betrieb bis hin zur Entsorgung.
Weiterhin sollen bis 2050 alle Bestandsgebäude der EU Nullemissionsgebäude sein. Hier sei der leichte Einbau ein Vorteil, denn Infrarotheizungen lassen sich einfach ans Hausnetz anschließen. Sinkende Stromkosten wirken sich zugunsten der elektrischen Heizung aus.
Viel investiert, wenig gespart
Michel Böhm, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, rechnete vor: Zwischen den Jahren 2010 und 2022 wurden rund 545 Milliarden Euro (Vollkosten) in die energetische Sanierung von Wohngebäuden investiert. In der Summe hätten sie allerdings keine Energieeinsparungen bewirkt.
Die Kostensteigerung im Bau sei aktuell die größte Herausforderung. „Die mit Abstand stärkste Kostenentwicklung ist beim technischen Ausbau festzustellen“, sagte Böhm. Einfachere Technik sei eine Lösung, um Kosten zu reduzieren, und hier seien Infrarotheizungen ein guter Weg.
Abrechnung der Heizkosten
Wenn die Energie für die Versorgung im Gebäude (Strom und Wärme) überwiegend solar erzeugt werde, sei laut Heizkostenverordnung (Paragraf 11, Absatz 1, Nummer 3) keine Heizkostenabrechnung nötig. Dies solle auch nicht eingeschränkt werden.
Böhm sieht vor allem in Mehrfamilienhäusern durch niedrige Betriebskosten, geringen Wartungsaufwand und flexible Einbindung in Mietmodelle wie die Pauschalmiete mit Energieflatrate viel Potenzial für Infrarotheizungen. Auch im Denkmalschutz gebe es schon vorbildliche Projekte mit Hybridsystemen.
Das Gebäude als Energiezentrale
Frank Hummel ist Berater für die Elektrifizierung von Unternehmen, Gebäuden und Quartieren. In seiner Präsentation zeigte er auf, welche Chancen in der Umstellung auf elektrische Energieversorgung liegen. „Wer früh investiert, spart langfristig“, appellierte Hummel und machte deutlich: Gebäude der Zukunft sind weit mehr als nur Immobilien – sie sind Energiezentralen.
Der Experte hat zahlreiche Projekte begleitet, zum Beispiel das Firmengebäude der HSG im schwäbischen Frickenhausen. Das Bürogebäude mit 385 Quadratmetern wurde 2012 errichtet. Das Energiekonzept basiert auf Photovoltaik, Stromspeicher und Infrarotheizungen.
Besonders eindrucksvoll ist der Vergleich zwischen der Berechnung nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und dem tatsächlichen Verbrauch: Die reale Heizenergie lag von Januar bis Dezember 2024 bei lediglich 33 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und damit deutlich unter dem ursprünglich berechneten Bedarf von 97,5 Kilowattstunden mit Infrarotheizung.
Extrem niedriger Primärenergiebedarf
Auch der Primärenergiebedarf zeigt das Potenzial der elektrischen Versorgung. Er wurde nach EnEV mit 253,6 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr berechnet. Beim Bezug von zertifiziertem Grünstrom – ohne Berücksichtigung der eigenen Photovoltaikanlage – kann ein Primärenergiefaktor von 0,4 angesetzt werden (gemäß GEG oder Bafa). Damit ergibt sich ein rechnerischer Primärenergiebedarf von nur 13,2 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
Dieser Wert dient als Beispiel zur Veranschaulichung, wie stark sich der Primärenergiebedarf durch die Wahl der Energiequelle reduzieren lässt. Hummel schlussfolgerte: Dieser Aspekt sollte künftig bei jeder energetischen Gebäudeplanung berücksichtigt werden.
Klimaschonend und wirtschaftlich
Für die Wärmewende und die Förderung spielen die Effizienzstandards der KfW eine maßgebliche Rolle. Infrarotheizungen können im Neubau und in der Sanierung die maximale Förderung als KfW-55-Häuser beziehungsweise KfW-40-Standard erreichen. Joachim Schrader, Geschäftsführer der Firma Bauen plus Energie Konzept, erläuterte, wie solche Modelle in den Programmen der Energieberater gerechnet werden.
Schrader setzt auf ein Energiekonzept, das nahezu klimaneutral ist, bei dem keine fossile Energie verbraucht wird, das eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt, reduzierte Kosten für die Haustechnik und maximale Förderung möglich sind. Photovoltaik und Infrarotheizungen sind der Kern dieses Konzeptes.
Gaststätte in der Eifel
Bei seiner Planung reduziert er die Wärmebrücken und somit den Heizenergiebedarf. Dann legt er mit der niedrigen Heizlast die IR-Heizflächen aus. Durch vergleichsweise niedrige Anschaffungskosten sinken die gesamten Baukosten. Dies erläuterte er für den Neubau der Klostergaststätte in Maria Laach in der Eifel. Vor dem Neubau hätten die Betreiber knapp 19.800 Kilogramm Kohlendioxid pro Jahr produziert und nicht einmal den gesetzlich geforderten Neubaustandard erreicht. Durch das sogenannte Klimapaket von Schrader wurden die Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zur vorliegenden Fachplanung auf 2.070 Kilogramm pro Jahr reduziert.
Ähnlich bei den Brennstoffkosten: Zuvor lagen sie bei 5.700 Euro im Jahr. Mit Schraders Planung sanken sie auf rund 640 Euro jährlich. Die Einsparung für die Klostergaststätte liegt bei 1,13 Millionen Euro für die nächsten 30 Jahre.
Saniertes Wohngebäude in Wiesbaden
Für Bestandsgebäude erläuterte Schrader die Sanierung einer Hofreite in Wiesbaden. Ursprünglich war nur eine Wohneinheit geplant. Er rechnete mit fünf Wohnungen, um eine höhere KfW-Förderung zu bekommen. Die Baukosten wurden deutlich reduziert, unter anderem durch Einsparungen von 120.000 Euro für die Haustechnik.
Schrader integrierte Infrarotheizungen (Hauptheizung), dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und dezentrale Warmwasser-Wärmepumpen. Der Bauherr bekam die maximal mögliche KfW-Förderung von 272.500 Euro. Der Betrieb ist nun klimaneutral. Die Brennstoffkosten betragen nur rund 800 Euro im Jahr.
Pauschalmiete inklusive Flatrate für Energie
Höhere Renditen sind für Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld ein zentrales Argument. Der sächsische Energieexperte hat mit seinem Autarkieteam das Konzept der hochgradig energieautarken Gebäude entwickelt. Er plant die Energiekonzepte mit Photovoltaik, Stromspeichern und Infrarotheizungen für die Raumheizung sowie Autarkieboiler für Warmwasser.
Bislang hat er Energiekonzepte für Gebäude mit 1.271 Wohneinheiten erstellt. Davon wurden 892 Wohnungen mit Infrarotheizungen ausgestattet. In Lübben im Spreewald stehen die ersten Mehrfamilienhäuser mit dieser Technik. Die niedrigen, langfristig planbaren Energiekosten durch den hohen Solarertrag ermöglichen es den Eigentümern, eine Pauschalmiete inklusive Neben- und Energiekosten anzubieten (Flatrate).
Etliche gelungene Projekte
In Würzburg stellte Leukefeld diverse Projekte vor, darunter Mehrfamilienhäuser, eine Quartierslösung in Bad Liebenwerda und kommunale Gebäude wie eine Kindertagesstätte in Wiesbaden. Ein Leuchtturmprojekt ist die Sanierung von drei DDR-Plattenbauten in Aschersleben in Sachsen-Anhalt. Zwei der sanierten Gebäude sind mittlerweile vermietet und bezogen.
Das erste sanierte Gebäude kam durch die Sanierung auf KfW-Effizienzhaus-Standard 55 und beherbergt 22 Wohnungen. Auf dem Dach und an den Fassaden sind Photovoltaikanlagen mit 184 Kilowatt in Betrieb. Der Solarstrom wird in zwei Stromspeichern mit insgesamt 120 Kilowattstunden Kapazität gesammelt.
Die solare Deckung für Heizung, Warmwasser, Haushalts- und Allgemeinstrom lag im ersten Betriebsjahr bei knapp 60 Prozent. Eigentümer der Gebäude ist die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft. Sie bezieht im Jahr nur 53.400 Kilowattstunden Reststrom.
Geringere Kosten steigern Mietrendite
Die spezifischen Gesamtenergiekosten für Wärme und Strom beziffert Leukefeld auf 0,67 Euro pro Quadratmeter und Monat. Im Mai 2023 zogen die ersten Mieter ein. Für Wohnungen ohne Aufzug wurde ein Pauschalmietpreis von 11,50 Euro je Quadratmeter auf fünf Jahre festgesetzt.
Die Pauschalmiete erspart Vermietern aufwendige Nebenkostenabrechnungen, was die Mietrendite steigert. „Das ist ein wichtiges Argument für die renditeorientierte Wohnungswirtschaft“, erläuterte Leukefeld. Auch die Netzdienlichkeit der Energietechnik gewinne an Bedeutung. Daher gestalte er die Energietechnik für die Beheizung und Stromversorgung netzdienlich. „Die Gebäude sind aktuell noch nicht von außen vom Energieversorger steuerbar, weil es das real noch nicht gibt“, sagte er. „Aber sie sind darauf vorbereitet. Wir können künftige Gebäude so verkabeln, dass der Akku, der Autarkieboiler und die Infrarotheizung ansteuerbar sind.“
Für den ersten sanierten Plattenbau hatte der Energieversorger eine Anschlussleistung von 360 Kilowatt gefordert. Die maximale Leistung wurde mit 70 Kilowatt gemessen, die maximale Einspeiseleistung lag bei 109 Kilowatt, berichtete Leukefeld. Nun reicht die Anschlussleistung auch für die anderen Plattenbauten mit gleichem Energiekonzept.
Hochgradig energieautarke Mehrfamilienhäuser
Ein weiteres Bauprojekt, für das Leukefeld das Energiekonzept geplant hat, ist das hochgradig energieautarke Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen in Ehingen bei Augsburg. Rössler Wohnbau hat es gebaut. Geschäftsführer Markus Rössler stellte diese und weitere Projekte im Neubau und in der Sanierung vor. Im November 2022 war das Gebäude mit KfW-Standard 40 plus und 325 Quadratmetern beheizter Wohnfläche bezugsfertig. Auf dem Dach und an der Balkonbrüstung sind Solarmodule mit 49,15 Kilowatt Gesamtleistung in Betrieb. Der Stromspeicher fasst 59,5 Kilowattstunden. In den Wohnungen sorgen Infrarotheizungen für Wärme. Autarkieboiler erhitzen dezentral das Trinkwasser.
Schub fürs Baugeschäft
Durch die erste Jahresenergiebilanz weiß Rössler, dass der solare Deckungsgrad für Strom und Wärme real bei 68 Prozent liegt. Vom erzeugten Solarstrom verbrauchten die Bewohner im Jahr 17.432 Kilowattstunden direkt. 30.204 Kilowattstunden wurden für 7,6 Cent ins Stromnetz eingespeist. Der Zukauf an Strom erreichte 7.936 Kilowattstunden zu 29 Cent brutto je Kilowattstunde. Rössler, der selbst Eigentümer ist, vermietet ebenfalls mit Pauschalmiete inklusive Energie- und Nebenkosten.
Mit dem innovativen Ansatz hat der Bauunternehmer viel Aufmerksamkeit erhalten und schon weitere hochgradig energieautarke Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut, oder er plant und errichtet sie gerade. 90 Prozent seiner Aufträge seien hochgradig energieautarke Häuser, berichtete er in Würzburg. Der solare Deckungsgrad liege zwischen 65 und 75 Prozent.
Solare Einfamilienhäuser mit IR-Heizungen
Die Konferenz wurde durch die Vorstellung mehrerer Einfamilienhäuser mit Photovoltaik, Stromspeicher und Infrarotheizungen für private Eigentümer abgerundet. Neue Einfamilienhäuser, zum Beispiel mit KfW-Effizienzhaus-Standard 40, sind aufgrund des minimalen Heizenergiebedarfs prädestiniert für strombasierte Energiekonzepte. Durch Solarstrom in Ergänzung mit Ökostrom wird die Stromversorgung emissionsfrei.
Ein Beispiel ist der 220-Quadratmeter-Neubau, den Hartmut Hartmann, Geschäftsführer der Firma Blowfill in Ostfriesland, präsentierte. Das Haus erfüllt den KfW-Standard 40 plus. Auf dem Dach stromt eine Photovoltaikanlage mit 9,9 Kilowatt Leistung. 2024 verbrauchten die Bewohner 8.761 Kilowattstunden Strom, inklusive des Energieverbrauchs für die Infrarotheizungen. Die Solaranlage erzeugte 9.621 Kilowattstunden Solarstrom.
Für die gesamte Haustechnik inklusive Photovoltaik und Speicher, Infrarotheizungen, Elektrotechnik, Warmwasserboiler und Lüftung zahlten die Eigentümer 74.200 Euro brutto. Hartmann berichtete, dass er derzeit mehrere Einfamilienhäuser und vier Mehrfamilienhäuser mit diesem Energiekonzept in Arbeit hat.
Hoher Wärmekomfort
Christoph Weiland, Geschäftsführer von Welltherm, stellte ein modernes Einfamilienhaus in Attendorn im Sauerland vor. Dort zahlen die Eigentümer unter 100 Euro im Monat für Haushaltsstrom, Warmwasser und die elektrische Heizung.
Das Energiekonzept beinhaltet ebenfalls eine Photovoltaikanlage, Speicher und Infrarotheizflächen. Neben den niedrigen Energiekosten hob Weiland die hohe thermische Behaglichkeit durch die direkte Strahlungswärme von Infrarotheizungen hervor: „Wirtschaftlichkeit trifft Komfort.“
Bernd Morschhäuser ist Geschäftsführer von Vitramo. Er präsentierte ein Niedrigenergiehaus von 2013 mit 164 Quadratmetern Wohnfläche. Die Photovoltaikanlage in Ost-West-Ausrichtung leistet 11,67 Kilowatt. Für die Infrarotheizungen mit Thermostaten in allen Wohnräumen zahlten die Bauleute knapp 7.600 Euro netto, für die Brauchwasser-Wärmepumpe 2.200 Euro.
Eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung hätte im Jahr 2013 rund 30.000 Euro gekostet. Die Einspeisevergütung für überschüssigen Solarstrom und der selbst verbrauchte Solarstrom decken die Heizkosten.
Steigende Nachfrage und mehr Projekte
Philipp Haller, Geschäftsführer der Haller Energiefreiheit, stellte ein 2021 gebautes Holzhaus mit KfW-40-Standard vor. Die Photovoltaikanlage mit 27,75 Kilowatt Leistung ist an einen Stromspeicher gekoppelt, dessen Kapazität Ende 2024 von zehn auf 17 Kilowattstunden erweitert wurde.
Die Infrarotheizungen haben elf Kilowatt Anschlussleistung, die Brauchwasser-Wärmepumpe 0,395 Kilowatt. 2023 lag der reale Energieverbrauch bei 7.700 Kilowattstunden, wovon 5.200 Kilowattstunden für Strom anfielen und 2.500 Kilowattstunden für den Kaminofen mit acht Kilowatt Nennleistung. Etwa 50 Prozent des Stromverbrauchs wurden durch Sonnenstrom gedeckt.
„Die über Jahre dokumentierten Energiebilanzen zeigen, wie stark Infrarotheizungen zur hervorragenden Energiebilanz und zu niedrigen Energiekosten beitragen können“, resümierte Lars Keussen, Vorstand der IG Infrarot. Dazu komme die besondere Eigenschaft der hohen thermischen Behaglichkeit von Infrarotsystemen.
Der nächste Runde Tisch der IR-Branche findet am 15. April 2026, die Konferenz am 16. April 2026 in Würzburg statt.
IR-Heiztechnik
Studien und Beispiele im Überblick
Wirtschaftlichkeit trifft Komfort – Infrarotheizung und Photovoltaik im KfW-40-Fertighaus; Christoph Weiland (Geschäftsführer Welltherm GmbH):
https://welltherm.de/besuch-bei-familie-r-aus-attendorn.php
Infrarotheizung so günstig, dass Photovoltaik mit drin ist; Bernd Morschhäuser (Geschäftsführer Vitramo GmbH):
https://www.infrarotheizung-vitramo.de/infrarotheizung/Realisierte-Proj…
Erfahrungswerte aus der Praxis – Infrarotheizungen als vollwertige Alternative; Phillip Haller (Geschäftsführer Haller Energiefreiheit GmbH):
https://www.haller-infrarot.com/unternehmen/referenzen/neubau-holz100-h…