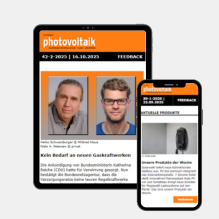Mit dem Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur kann auch die Elektromobilität weiter Fahrt aufnehmen. Denn vor allem in urbanen Regionen ist es eine Herausforderung für die Elektromobilisten, einen Punkt zu finden, um ihre Autos zu laden. Dafür bieten sich Parkhäuser regelrecht an. Vor allem, wenn es sich um Park-and-Ride-Standorte an den Rändern der Großstädte handelt. Aber auch das Parkhaus neben dem Einkaufszentrum ist ein perfekter Ort, um Ladesäulen zu errichten.
Doch ganz so einfach, wie es sich anhört, ist es nicht. Das weiß Dennis Keller, verantwortlich für den Bereich Ladeinfrastruktur, Elektromobilität und Energiemanagement bei Contipark. Die Berliner Unternehmensgruppe betreibt in ganz Deutschland knapp 570 Parkeinrichtungen.
Laden im Roaming
Dazu gehören auch eine ganze Reihe von Parkhäusern. „Wir versuchen, dort, wo es vertraglich möglich ist, möglichst schnell unsere Parkeinrichtungen mit Ladesäulen auszustatten – sowohl die normalen Parkplätze als auch die Parkhäuser“, erklärt Dennis Keller. „Wir bauen die Ladeinfrastruktur komplett ohne Fördermittel auf. Wir investieren in Eigenregie und refinanzieren diese Investition über die Ladegebühren.“
Das ist derzeit noch ein schwieriges Geschäftsmodell. Denn die Investitionen sind hoch und es dauert lang, bis sie wieder reingeholt sind. „Wir bieten dazu an vielen Standorten unsere eigenen Parkkarten an. Doch viele laden immer noch über das Roaming-Modell“, erklärt Dennis Keller.
Diese Kunden haben eine Ladekarte, mit der sie an vielen Standorten laden können, ohne sich an einen Anbieter zu binden. „Das schränkt Betreiber, wie wir es sind, ein wenig bei der Produktgestaltung ein, auch wenn das barrierefreie Laden natürlich positiv ist für den Ausbau der Elektromobilität. Dadurch sind wir auf die Preisstrukturen der jeweiligen Ladeanbieter, der sogenannten Mobility Service Providers oder MSP, angewiesen“, beschreibt Dennis Keller die Situation.
Kooperation mit der Bahn
Dazu kommt noch die kommunikative Seite mit dem Kunden. Die MSP legen ihre eigenen Preise fest. „Dadurch können wir dem Kunden nicht an der Ladesäule anzeigen, wie viel er für seinen Strom bezahlen wird“, sagt Keller.
Dennoch geht Contipark in Vorleistung. In einigen Fällen beteiligen sich auch die Betreiber der Parkhäuser oder Tiefgaragen. Schließlich haben sie einen Vorteil von der Investition in die Ladeinfrastruktur in Form von Kundenbindung. Das gilt hauptsächlich für die Einkaufscenter, die die angeschlossenen Parkhäuser betreiben und so ihren Kunden einen Mehrwert bieten.
Das gilt auch für Parkhäuser in der Nähe von Bahnhöfen, die Contipark betreut. „Denn wir haben noch ein Joint Venture mit der Deutschen Bahn, die DB Bahnpark. Auch da ist der Wunsch aller Beteiligten groß, möglichst zügig Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen“, sagt Dennis Keller.
AC-Ladepunkte reichen meist aus
Inzwischen hat das Unternehmen gut 2.000 Ladepunkte in den Parkeinrichtungen installiert. „Wir betreiben zwischen 30 und 40 Ladepunkten pro Parkeinrichtung“, erklärt Keller. „Das sind insgesamt rund 60 Ladestandorte, die wir den Fahrern der Elektroautos bieten.“ Der größte Teil davon sind AC-Ladepunkte mit 22 Kilowatt Leistung. „Denn der Besitzer des Elektroautos erwartet nicht, dass in einem Parkhaus oder einer Tiefgarage eine Schnellladestation ist. Außerdem bleiben dort die Autos in der Regel mehr als zehn oder 20 Minuten stehen, sodass die AC-Ladesäulen zur Kundenstruktur passen.“
Schnelllader mit Leistungen von 150 und mehr Kilowatt baut Contipark vorwiegend auf Parkplätzen. Dort ist der Aufbau von Schnellladern auch einfacher als in einem Parkhaus. Denn die drei Themen, die Dennis Keller bei Contipark betreut, sind eng miteinander verzahnt. Die Ladeinfrastruktur ist wichtig für die Elektromobilität.
Netzanschluss ist das Nadelöhr
Das Energiemanagement wiederum ist ein zentraler Bestandteil der Ladeinfrastruktur in Parkhäusern. Schließlich sind die Netzanschlussleistungen immer begrenzt. „Auch wenn wir derzeit immer wieder prüfen, ob wir die Netzanschlussleistungen ausbauen, und dies auch in manchen Fällen tun. Doch dann ist man bei Planungshorizonten von ein bis zwei Jahren“, sagt Keller.
Dazu kommen noch die Probleme mit dem Anschluss an das Verteilnetz. „Die Genehmigungsprozesse sind aufwendig und langwierig“, ergänzt er. „Dazu kommt noch, dass wir manchmal nur fünf oder sechs Ladepunkte genehmigt bekommen, obwohl wir 30 oder 40 beantragt haben. Das macht den Aufbau der Ladesäulen kompliziert und unbefriedigend.“
Inzwischen hat das Unternehmen begonnen, die Ladeinfrastruktur mit Photovoltaikanlagen zu unterstützen – zumindest dort, wo es möglich ist. So baut Contipark derzeit an Parkeinrichtungen in Bielefeld und Jena Photovoltaikanlagen auf. Auch die Kombination mit Speichern steht schon an, um die Ladeleistung abzufedern und die begrenzten Netzanschlüsse nicht zu überfordern.
Solar und Speicher unterstützen
Pilotanlagen sind schon geplant. „Doch es ist derzeit noch eine Herausforderung, das großflächig auszurollen“, erklärt Dennis Keller. „Wir versuchen, nicht nur bei der Installation der Ladeinfrastruktur, sondern auch bei der Kombination mit Photovoltaik und Speichern eine gewisse Standardisierung zu erreichen. Denn wenn wir das nicht skaliert bekommen, wird es schwierig mit der Wirtschaftlichkeit.“
Speicher könnten einige Probleme lösen. Doch auch ohne sie ist die Infrastruktur schon gut aufgestellt. Schließlich hat Contipark an jedem Standort ein dynamisches Lastmanagement integriert, über das die gesamte Ladeleistung auf die Autos verteilt wird. „Derzeit sind wir mit Blick auf die Ladeleistung noch in der komfortablen Situation, dass die Nachfrage bisher nicht so hoch ist, sodass wir mit den Ladeleistungen nicht an die Grenzen der Netzanschlussleistung stoßen“, sagt Dennis Keller. „Aber grundsätzlich berechnet sich die Ladeleistung jedes Ladepunktes aus dem Bedarf des Fahrzeugs.“
Ladeleistung am Bedarf ausrichten
Das heißt, wenn ein Auto mit einem niedrigen Ladezustand angeschlossen wird, erkennt dies das Lademanagement. Es wird diesem Auto mehr Leistung zuteilen als einem Fahrzeug, das schon einen hohen Ladezustand erreicht hat. „So passt das Lademanagement die Ladeleistung an die jeweilige Situation im Gesamtsystem an“, erklärt Keller. „Es ist ein Zusammenspiel aus notwendiger Ladeleistung der Fahrzeuge und unserer verfügbaren Leistung.“
Schließlich haben die Autos auch sehr unterschiedliche Ladekurven und der Bedarf an Leistung nimmt mit zunehmendem Ladezustand des Fahrzeugs ab. Auf diese Weise kann Contipark ausreichend Ladeleistung für jedes Fahrzeug bereitstellen.
We Tower
Elektroautos übereinander laden
Eine clevere Nutzung des raren Parkraums in Städten in Kombination mit einer Ladeinfrastruktur für Elektroautos hat WE Tower entwickelt. In dem gleichnamigen Parkhochhaus können auf einer Fläche von lediglich 50 Quadratmetern bis zu 30 Elektroautos nicht nur geladen, sondern auch clever verstaut werden.
Der erste WE Tower wurde in Berlin eingeweiht. Am Standort in Spandau in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof Stresow bietet das Parkhaus Platz für zehn Elektroautos. Mit dem Projekt zielt das Unternehmen auf Berufspendler ab, die hier in den öffentlichen Nahverkehr umsteigen.
Für das Parkhaus hat Burhan Aykut, Geschäftsführer von WE Tower, ein eigenes patentiertes System entwickelt. Die Elektroautofahrer steuern ihr Fahrzeug in das Parkhaus auf eine Plattform. Diese ist mit einer 22-Kilowatt-Ladesäule ausgestattet. Nachdem das Elektroauto angeschlossen ist, fährt die Plattform nach oben und wird seitlich in die Parkposition geschoben. Danach holt der Fahrstuhl eine freie Plattform und fährt sie nach unten, damit das nächste Auto einfahren kann.
Kommt der Elektroautofahrer zurück, transportiert der Fahrstuhl die Plattform mit seinem Auto nach unten. Kurz bevor sie unten ankommt, wird die Plattform um 180 Grad gedreht. Auf diese Weise kann der Besitzer sein Auto vorwärts aus dem Parkhaus herausfahren, obwohl er es vorwärts hineingefahren hat.
Die Ladesäulen werden in erster Linie von den auf dem Dach des WE Towers und auf dem Gelände installierten Solaranlagen versorgt. Drei stationäre Speicher sorgen dafür, dass immer ausreichend Leistung zur Verfügung steht, ohne dass der Netzanschluss ausgebaut werden musste. Sie unterstützen auch die zusätzlich auf dem Gelände außerhalb des WE Towers installierten DC-Schnellladesäulen.
https://www.we-tower.com/
Foto: Velka Botička
T-Werk
Standardisierte Solarfassade für Parkhäuser
Der Montagesystemanbieter T-Werk aus dem bayerischen Burgau hat eine standardisierte Unterkonstruktion für Photovoltaik an Parkhausfassaden entwickelt. Das Montagesystem ist anwendbar bei allen Parkhäusern, die mit Doppel-T-Trägern gebaut sind.
Es wird ohne Schrauben und Bohren, sondern ausschließlich mit Klemmpratzen montiert. Dadurch ist das System zügig und einfach montiert. T-Werk bleibt dabei seinem Prinzip der modularen Komponenten treu. Denn das System basiert auf bestehenden Unterkonstruktionen von T-Werk. So werden für die Fassadenmontage die Profile des Schrägdachsystems Zelos und die Klemmen des Systems Chronos verwendet, das auch für Schräg- und Trapezblechdächer entwickelt wurde. Dadurch können die Handwerker die Komponenten nutzen, die sie schon kennen und ohnehin am Lager haben.
Die Nutzung der Parkhausfassaden bietet mehrere Vorteile. So kann der vor Ort erzeugte Strom in Kombination mit einer Ladesäuleninfrastruktur direkt für die Elektromobilität genutzt werden. Mit Überschüssen können die Parkhausbetreiber zudem ihre Betriebskosten reduzieren und ihr Image oder das der Kommune im Bereich Nachhaltigkeit verbessern. Zudem erzeugen vertikal angebrachte Photovoltaikanlagen in der sonnenärmeren Zeit, morgens und abends sowie in den Wintermonaten, zuverlässig Strom. Denn durch die vertikale Montage bleibt kaum Schnee auf den Modulen liegen und die Paneele sind optimaler zur tiefer stehenden Sonne ausgerichtet als die von Dachanlagen.
https://t-werk.eu
Foto: T-Werk