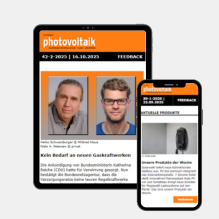Derzeit verfügen Gewerbespeicher hierzulande über 1,14 Gigawattstunden Energieinhalt. Im Vergleich zu Heimspeichern mit 18,55 Gigawattstunden und Großspeichern mit 3,15 Gigawattstunden ist es aktuell das kleinste Segment. Allerdings wächst der Markt rasant und hat sich etwa innerhalb nur eines Jahres verdoppelt. Das lässt sich aus den Battery Charts der beiden Institute ISEA und PGS der RWTH Aachen ablesen. Gewerbespeicher liefern zwischen 30 Kilowatt und einem Megawatt Leistung und zwischen 30 Kilowattstunden und einer Megawattstunde Kapazität. So lässt sich das Segment abgrenzen. Gewerbespeicher dienen dabei vor allem dem solaren Eigenverbrauch sowie der Lastspitzenkappung in den Unternehmen oder der Schnellladung von Elektrofahrzeugen. Nun kommen auch immer häufiger Optionen wie smarte Stromtarife und die Vermarktung an der Strombörse hinzu.
Schnelle Amortisation der Strompuffer
Auch deshalb hat Solarwatt nun sein Produktportfolio um Speicherlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen erweitert. Die neuen Systeme bieten flexible Einsatzmöglichkeiten und sollen Unternehmen helfen, Energiekosten zu senken. Das Unternehmen aus Dresden bietet neue Großspeicher und passende Wechselrichter in einem Komplettsystem an. „Wir sind damit ab sofort in der Lage, auch große Solarprojekte mit Speicher komplett aus einer Hand abzubilden“, erklärt Peter Bachmann.
Der Solarwatt-Manager beobachtet am Markt, dass immer mehr Betriebe auf Solaranlagen mit Batteriespeicher setzen, einfach um Energiekosten zu senken. „Im Durchschnitt amortisiert sich eine gewerbliche Solaranlage mit Batteriespeicher schon nach etwa sieben Jahren“, erklärt Bachmann.
Gewerbespeicher als AC- und DC-Hybridvariante
Zusätzliche Einsparungen seien durch die Nutzung dynamischer Stromtarife möglich. Unternehmen könnten Energie gezielt dann aus dem Netz beziehen, wenn die Preise an der Strombörse niedrig sind, und diese im Batteriespeicher zwischenspeichern. „Dadurch können Betriebe mehrere Tausend Euro an Energiekosten sparen – und zwar pro Jahr“, rechnet Bachmann vor.
Die neuen Gewerbespeicher sind dabei als AC- und als DC-Hybridvariante erhältlich. Der AC-Speicher bietet eine Leistung von 125 Kilowatt und eine Kapazität von 261 Kilowattstunden. Das wassergekühlte System ermöglicht höhere Energieströme. Der luftgekühlte DC-Hybridspeicher erreicht eine maximale Leistung von 60 Kilowatt und eine Kapazität von bis zu 200 Kilowattstunden. Beide Speicher können in bestehende Energiesysteme integriert werden – und bis zu zehn Geräte lassen sich parallel schalten.
Die Speicher sind notstromfähig und verfügen über ein Sicherheitskonzept, das Schäden durch Überhitzung und Feuer verhindert. Sie können auch ohne Überdachung im Freien stehen, was zusätzliche Installationskosten spart. Ein integriertes Energiemanagementsystem überwacht die Energieflüsse, optimiert den Eigenverbrauch und ermöglicht die Einbindung dynamischer Stromtarife.
Software erleichtert Planung und Analyse
Solarwatt hat zudem eine neue Software entwickelt, die Unternehmen bei der Planung ihrer Solaranlagen mit Gewerbespeicher unterstützt. Das Tool analysiert das Lastprofil eines Betriebs und berechnet die optimale Anlagengröße sowie die passende Speicherkapazität. Es simuliert Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite, den Autarkiegrad und den Zeitpunkt der Amortisation. Auch die Nachrüstung von Speichern bei bestehenden Anlagen oder die Dimensionierung für zukünftige Ladeinfrastruktur können damit bewertet werden. Bachmann: „Das gibt Unternehmen einen sehr guten Überblick darüber, was sie von ihrem Investment erwarten können.“
Das Firmengebäude von Brenntag im sächsischen Glauchau wurde von Solarwatt mit Photovoltaik und Batteriespeicher bestückt. Auf den Dächern wurden 698 Solarmodule mit insgesamt 313,65 Kilowatt Leistung installiert. Der Batteriespeicher puffert 215 Kilowattstunden. Die Investition liegt bei rund einer halben Million Euro. Brenntag gehört zu den großen Distributoren von Chemikalien und investiert in die nachhaltige Transformation seiner energieintensiven Geschäfte. Mithilfe des Batteriespeichers werden 63,8 Prozent des Sonnenstroms im Unternehmen verwendet – und so fast 52 Prozent seines Strombedarfs gedeckt.
BSW-Solar: 100 Gigawattstunden bis 2030
Hochrechnungen des BSW-Solar auf Basis von Daten der Bundesnetzagentur haben ergeben, dass in Deutschland Ende Juli 2025 rund 2,2 Millionen stationäre Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von insgesamt rund 23 Gigawattstunden in Betrieb waren. Mehr als 22 Gigawattstunden liefern dabei Speicher mit LFP-Zellen. Aber auch Projekte mit Speichern auf Natrium-Ionen-Basis gibt es zunehmend mehr. Der BSW-Solar fordert, den Ausbau stationärer Batteriespeicher weiter zu beschleunigen und ihre gewaltigen Potenziale als Effizienzbooster der Energiewende künftig noch besser zu heben.
Die Bundesregierung solle sich bis 2030 eine Batteriespeicher-Mindestkapazität von 100 Gigawattstunden gesetzgeberisch zum Ziel setzen, so eine zentrale Forderung des Verbandes. Denn die Vorteile von Batteriespeichern sind vielfältig: „Sie reduzieren den Bedarf an Reservekraftwerken und den Umfang des Netzausbaus, verringern Abregelungen von Ökostromanlagen, deren Förderbedarf, stabilisieren die Börsenstrompreise und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Überbrückung von Dunkelflauten“, betont BSW-Chef Carsten Körnig.
Speicherhersteller warten auf Rückenwind
Um das volle Potenzial von Batteriespeichern zu erschließen, sei es entscheidend, bestehende Hemmnisse zeitnah zu überwinden und den regulatorischen Rahmen weiterzuentwickeln. Im Grundsatz habe dies auch die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag erkannt, meint Körnig.
Wie dringend die Speicherbranche jedoch auf konkreten politischen Rückenwind wartet, zeigen Ergebnisse einer Branchenumfrage des BSW-Solar in Kooperation mit der Speichermesse EES: Am dringendsten wünschen sich Unternehmen aus der Speicherbranche eine Beschleunigung und Vereinfachung von Netzanschlüssen (64 Prozent), die Verlängerung der Netzentgeltbefreiung beim Strombezug von Speichern (45 Prozent) sowie die klare Umsetzung von Multi-Use-Regeln für den flexiblen Einsatz von Speichern mit Solar- und Graustrom (ebenfalls 45 Prozent). Weitere Unternehmen und Branchenakteure können sich gern an der laufenden Umfrage zu Batteriespeichern beteiligen.
https://www.solarwirtschaft.de

Foto: Solarwatt
Phenogy
Natrium-Ionen-Großspeicher in Bremen startet
Phenogy hat in Bremen einen Batteriegroßspeicher auf Natrium-Ionen-Basis in Betrieb genommen. Der Speicher ist bei der Firma Solares Energy mit einer Photovoltaikanlage mit 50 Kilowatt gekoppelt und läuft derzeit im Inselbetrieb. Das Schweizer Unternehmen Phenogy hat das System mit der Bezeichnung Phenogy 1.0 speziell für den Einsatz in Industrie, Gewerbe, Netz- und Ladeinfrastruktur entwickelt. Der Natrium-Ionen-Speicher leistet 400 Kilowatt und nimmt knapp eine Megawattstunde auf.
Die Natrium-Ionen-Technologie bietet laut Phenogy Vorteile gegenüber Lithiumbatterien. Denn Natrium ist weltweit verfügbar und kann umweltschonend gewonnen werden, was eine geopolitisch stabile Rohstoffbasis schafft. Zudem zeichnet sich die Technologie durch hohe thermische Stabilität, minimiertes Brand- und Explosionsrisiko sowie robuste Leistung auch unter extremen Betriebsbedingungen aus, wie der Hersteller herausstellt.Das luftgekühlte System ermöglicht eine sichere und langlebige Energiespeicherung bei gleichzeitig reduziertem CO2-Fußabdruck. „Mit modernster Natrium-Ionen-Technologie bieten wir Energiespeicher mit langer Lebensdauer, hoher Sicherheit und zuverlässiger Leistung auch bei extremen Temperaturen“, erklärt Max Kory, Technikchef bei Phenogy. Die Luftkühlung reduziert zudem Wartungsaufwand und Kosten.

Foto: Phenogy
Solation
Virtuelle Batterie für Gewerbeimmobilien
Solation und Solaredge haben ein neues Konzept für Gewerbegebäude mit mehreren Mietern hierzulande: Eine virtuelle Batterie ermöglicht eine effiziente Nutzung von Solarstrom ohne physische Speicher. Das Konzept entspricht der Mieterstromverordnung und soll den Eigenverbrauch von Solarenergie in Gebäuden deutlich steigern.
Vermieter und Mieter profitieren demnach von einer garantierten Ermäßigung von zehn Prozent auf ihre Energiekosten. Eine virtuelle Batterie speichert ungenutzten Solarstrom ebenfalls virtuell und verteilt ihn später an die Mieter. Dadurch wird der Eigenverbrauch des
Gebäudes maximiert, ohne dass physische Batteriespeicher erforderlich sind. Solation übernimmt Planung, Installation, Betrieb und Abrechnung des Projekts. „Gewerbliche Mehrmietergebäude sind nach wie vor ein weitgehend unerschlossener Markt für Solarenergie“, sagt Sebastian Hugl, CEO von Solation. „Nicht wegen fehlender Dachflächen, sondern aufgrund regulatorischer und buchhalterischer Hürden.“
Die erste virtuelle Batterie arbeitet im Stuttgarter Gewerbegebiet Weilimdorf. Das Gebäude Frio 3 verbraucht jährlich 270 Megawattstunden, ist jedoch mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die 95 Megawattstunden erzeugt. Durch die virtuelle Batterie werden bereits 83 Prozent der täglich produzierten Solarenergie im Gebäude genutzt. Überschüssige Energie wird ins Netz eingespeist. Laut Solation amortisiert sich die Solaranlage in Stuttgart bereits nach 5,3 Jahren. Das Konzept beseitigt regulatorische Hürden und erschließt neue Märkte für Sonnenstrom.

Foto: Morrison